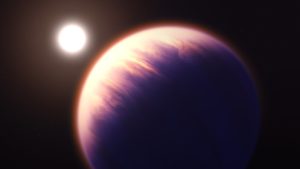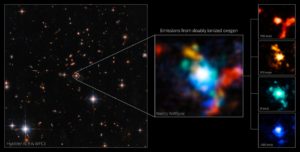Als ich das Licht der Welt erblickte, war mein Vater in der Karnevalssession 1936/1937 im Kölner Dreigestirn die Jungfrau Josefa. Damit bin ich einer der wenigen Männer, die von einer Jungfrau geboren wurden.
Hier der Link der damaligen Proklamation
Er war vor dem zweiten Weltkrieg der letzte Mann, der diese Rolle ausüben konnte. Danach wurde sie von Frauen übernommen, da Hitler der Meinung war, dass diese Verkörperung von Männern als Frau ekelhaft sei. Wir überlebten den Krieg, aber mein Vater verlor seine damalige Existenzgrundlage als Bierbrauer. Die Familie zog in die Heimat meiner Mutter nach Luxemburg. Aber Köln wurde nie vergessen.
So kam ich 1956 nach Köln zurück an die Nikolaus-Otto-Ingenieurschule und machte dort meinen Diplomingenieur für Starkstrom- und Nachrichtentechnik. Hier bekam ich meine erste Ehrung, und zwar wurde ich Ehrenmitglied bei der Ehrengarde Köln und musste meinem Vater stets darüber berichten. 1987 wurde mein Vater von der Ehrengarde eingeladen zum Jubiläum seiner 50jährigen Jungfrauenschaft. Er durfte mit dem Dreigestirn den Rosenmontagszug erleben. Er behauptete, das wäre die schönste Zeit seines Lebens gewesen. Dies verdankte er vor allen Dingen dem Präsidenten Friedel Haumann. Alle Achtung.
1960 bis 1968 vervollständigte ich mein Studium an der Universität zu Köln. Ich wurde erster Vorsitzender des internationalen Studentenbundes und mir fiel auf, dass die ausländischen Studenten gerade über Karneval sich heimatlos fühlten – Stichwort ‚Integration‘. Jede Fakultät hatte einen Karnevalsball, die Mediziner-, die Juristen-, die Philosophen-, die WiSo-Fakultät. Also entschieden sich meine Mitglieder einen Ball speziell für die karnevalistische Verständigung mit den ausländischen Studenten ins Leben zu rufen. Wir nannten ihn „Ko Ka In“- Ball. Eine Abkürzung von „Koelner Karneval International“. Ich wurde zum Präsidenten ernannt, der Ball entwickelte sich zu einem Fastelovent-Event sondergleichen;. anfangs in den Satory Sälen, zweimal im Gürzenich und danach immer sonntags vor Rosenmontag in sämtlichen Räumen der Wolkenburg am Mauritiussteinweg. 1500 – 2000 Karten fanden regelmäßig reißenden Absatz. Ich musste als Präsident natürlich alle einschlägigen Karnevalslieder beherrschen und machte davon auf der Bühne auch reichlich Gebrauch ( kaum einer verließ den Saal! ). Den Ko-Ka-In-Ball gab es bis ins Jahr 2004.
Natürlich blieb der Karneval für mich eine bedeutende Jahreszeit im Jahr. Unter anderem machte ich bei den Bläck Fööss in ihrer Revue: „usjebomb und objebaut“ mit, wo ich die Gelegenheit bekam, meinen Vater postum zu ehren.
Auch professionell war ich aktiv am Kölner Karneval beteiligt. So wurde ich zum Beispiel vom WDR zweimal beauftragt die Übertragung der Rosenmontagszüge zu moderieren. Als erstes im Dritten Programm und später in der ARD. Auch für den Luxemburger Lokalsender RTL, gestaltete ich in luxemburgischer Sprache zwei Reportagen, um den Kölner Karneval auch in LUX ins rechte Licht zu setzen.
Meine Ehrungen begrenzten sich nicht nur auf Köln.
Ich wurde zum Beispiel mehrfach zum Dr. humoris causa ernannt, zum Beispiel im hessischen Nidder und in Lippstadt (NRW). In Recklinghausen erhielt ich die silberne Ente, in Ratingen bekam ich den Itterorden und wurde mit einem schweren Schwert zum Ritter geschlagen, in Wuppertal den Ehrenpreis der Prinzengarde.
Aber auch der höchste Orden des Rheinischen Karnevals, der sog. Goldenden Narr aller Rheinischen Karnevalsgesellschaften wurde mir 2016 verliehen, ein Jahr vor Hans Süper, der leider im vorigen Jahr (2022) viel zu früh verstorbenen. Ich bekam die Ehre, die Laudatio für ihn zu halten – ein Highlight meiner karnevalistischen Karriere.
Auch Düsseldorf ehrte mich mit der sogenannten „karnevalistischen Reifeprüfung der Weiß-Fräcke“, im Rahmen einer großen Gala, in der ich eine Büttenrede halten musste. Lang anhaltender Applaus war mir sicher, denn ich verkündete bewusst eine Fake News: „Die Schlacht von Worringen ist unentschieden ausgegangen, ein Anlass dafür, dass wir uns als Kölner und Düsseldorfer wieder vertragen können.
Meinen größten Verdienst allerdings messe ich mir zu, dass es mir gelungen ist, meine angeheiratete italienische Familie mit Kind und Kegel definitiv an den Karneval herangeführt zu haben. Meine Ehefrau Pina, eine überzeugte Italienerin, organisierte sogar für den Ko-Ka-In-Ball eine Männerbauchtanzgruppe mit amüsanter Choreographie. Drei Jahre lang war diese Gruppe ein Highlight dieses internationalen Balls in der Kölner Wolkenburg. Das alles, um dem Ganzen ‚Nachhaltigkeit‘ zu verleihen.
Es gehört deshalb seit 20 Jahren zur Tradition, dass wir von Weiberfastnacht bis Karnevalsdienstag im Maritim in Köln zwei bis drei Zimmer belegen, um das wilde Treiben um den Karneval hautnah mitzuerleben, inklusive Veedelszüch usw.
Ach so, da fällt mir noch ein, dass ich auch einmal den gesamten Kölner Rosenmontagszug zu Fuß, also als Fußtruppe, verkleidet als eierlegende Henne mitgemacht habe, unter der Leitung des Nestors und ehemaligen Zugleiters Alexander von Chiari. Er war der Hahn in Verbindung mit Peter Jungen, der in der Kölner Gesellschaft eine wichtige Rolle spielt. Das bezeichne ich als meine ‚Kölner Reifeprüfung‘
Dr. humoris causa,
Jean Pütz