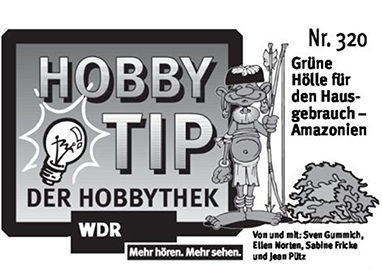General Motors will Handyträger für Autos sichtbar machen
Ungeschützt im Verkehr: Handy schützt (Foto: pixelio.de, U. Dreiucker)
Detroit (pte011/30.07.2012/13:45) – US-Autohersteller General Motors (GM) arbeitet an einer direkten Kommunikationsmöglichkeit für Autos mit Smartphones in der Umgebung. Durch eine ad-hoc-Verbindung, die direkt ohne Umweg über einen Knotenpunkt zustande kommt, könnten Autofahrer handytragende Fußgänger und Radfahrer in einem Umkreis von rund 183 Meter erkennen. Der WiFi-Direct-Standard ermöglicht Verbindungen, die schnell genug hergestellt werden, um brenzlige Situationen zu verhindern. Auf Smartphones muss für ein funktionierendes System allerdings eine entsprechende App installiert sein, die gerade von GM entwickelt wird.
Gefährdete Verkehrsteilnehmer
"In Österreich waren 2009 rund 19 Prozent der Verletzten im Straßenverkehr Fußgänger oder Radfahrer. Der Anteil an den Verkehrstoten beträgt sogar 22 Prozent. Gerade im innerstädtischen Bereich und im Ortsgebiet ist die Gefährdung für ungeschützte Verkehrsteilnehmer hoch. Auch im Bereich von Schutzwegen kommt es öfter zu Problemen. Systeme, die das Risiko für Fußgänger und Radfahrer senken können, sind zu begrüßen", sagt Florian Schneider vom Kuratorium für Verkehrssicherheit http://www.kfv.at gegenüber pressetext.
GM plant, das System mit bestehenden Technologien zum Erkennen von Gefahrenquellen zu kombinieren. "Es gibt im Bereich Fahrerassistenzprodukte schon Anbieter, die andere Ansätze verfolgen, um Gefahrenquellen im Nahbereich von Fahrzeugen zu erkennen", weiß Florian Schneider. Durch die Kombination mehrerer Systeme verspricht sich General Motors eine lückenlosere Überwachung der Fahrzeugumgebung. Durch den Einsatz von WLAN-Verbindungen können Handyträger sehr schnell und auch bei verdeckter Sicht erkannt werden.
Kein Access Point
Durch den Verzicht auf Access-Points bei WiFi-Direct wird die Zeit, die für das Herstellen einer Verbindung notwendig ist, auf eine Sekunde reduziert. Auch die Latenz der Verbindungen soll geringer sein. Um die Systeme tauglich für den Einsatz im Alltag zu machen, müssen die Autohersteller ihre Fahrzeuge erst serienmäßig mit WLAN-fähigen Kommunikationssystemen ausstatten. Die US-Autoindustrie arbeitet mit Hochdruck an entsprechenden Technologien.
Mit Unterstützung der Regierung starten die großen US-Autohersteller nächsten Monat ein Pilotprogramm, um für die Automobilindustrie taugliche Kommunikationsnetzwerke zu testen. Die ersten Smartphone-erkennenden Systeme sollen schon bald im Straßenverkehr auftauchen.
"In vielleicht fünf Jahren, spätestens zum Ende der Dekade, wird es soweit sein", sagt Donald Grimm von der General Motors Forschungs- und Entwicklungsabteilung. "Eine Warnung für die Fahrer macht sicher Sinn. Verbesserte Technik hat einen Anteil an den sinkenden Unfallzahlen. Es ist aber schwer zu sagen, wie hoch er ist, da Infrastruktur, Bewusstseinsbildung und andere Faktoren ebenfalls Auswirkungen haben", so Schneider