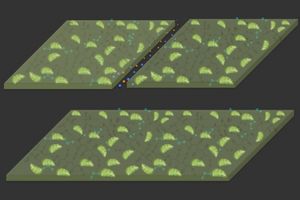Bio-Angeln für Seltene Erden
Wie Eiweiß-Bruchstücke Elektronik-Schrott recyceln
Ohne wichtige Schlüssel-Elemente, wie
Kupfer oder die Metalle der Seltenen Erden, funktioniert weder die
moderne Elektronik noch fließt elektrischer Strom. Ausgediente
Energiesparlampen, Handys, Computer und Schrotte könnten eine wichtige
Quelle für diese Rohstoffe sein, allerdings lassen sich die wertvollen
Hightech-Metalle von dort nur schwer zurückgewinnen. Es sei denn, man
angelt mit kleinen Eiweiß-Bruchstücken danach, die Forscher vom
Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR) und der Technischen
Universität Bergakademie Freiberg gerade in der Zeitschrift „Research in
Microbiology“ vorstellen.
Die defekte Energiesparlampe und das ausgediente
Handy wandern heutzutage mehr oder weniger zuverlässig über
Sammelbehälter in Großmärkten und andernorts zu den Wertstoffhöfen. Für
besonders wertvolle Inhaltsstoffe wie die Seltenen Erden Terbium,
Yttrium oder Lanthan, die oft nur in geringen Konzentrationen vorliegen
und die fest mit anderen Komponenten verbunden sind, gibt es allerdings
häufig noch keine wirtschaftlichen Recyclingtechnologien. „Allein 25.000
Tonnen Leuchtpulver der ausgedienten Energiesparlampen dürften daher in
der Europäischen Union bis zum Jahr 2020 gesammelt werden“, berichtet
die Biologin Dr. Franziska Lederer vom HZDR.
Fein verteilt stecken dort so exotisch klingende
Verbindungen wie Yttrium-Oxid, Lanthan-Phosphat,
Cer-Magnesium-Aluminium-Oxid und Barium-Magnesium-Aluminium-Oxid, die
Spuren von Terbium, Cer, Europium und anderen Seltenen Erden enthalten.
Die Seltenen Erden wiederum, ohne die weder Plasmabildschirme, noch
Generatoren von Windkraftanlagen oder Elektromotoren für Autos mit
Hybrid-Antrieb funktionieren, wurden in den vergangenen Jahren fast
ausschließlich in China gewonnen. Export-Beschränkungen können daher die
hiesigen Schlüsseltechnologien massiv in Mitleidenschaft ziehen.
Die Nachwuchsgruppe „BioKollekt“, die Dr. Lederer
seit dem 1. Oktober 2018 am Helmholtz-Institut Freiberg für
Ressourcentechnologie (HIF) – einem Institut des HZDR – leitet,
beschäftigt sich deshalb mit neuartigen Technologien, um Seltene Erden
beispielsweise aus dem Leuchtpulver ausgedienter Energiesparlampen zu
gewinnen. Mit diesen Methoden können aber auch wichtige Metalle wie
Kupfer und Gold aus dem Abraum von Bergwerken gewonnen oder Plastik
sortiert und wiederverwendet werden.
Das Vorbild für diese Techniken findet die Biologin
bei Viren, die auf Bakterien spezialisiert sind. Die Hülle dieser
winzigen „Bakteriophagen“ besteht aus rund 4.000 Proteinen. An diese
wurden mit molekularbiologischen Methoden kurze Protein-Bruchstücke
geheftet, die acht bis 16 Proteinbausteine lang sind. Von diesen
Peptiden gibt es viele unterschiedliche Formen, Franziska Lederer kann
daher mit einer Milliarde Bakteriophagen forschen, die jeweils
unterschiedliche Peptide besitzen. Eine solche Sammlung nennen
Molekularbiologen eine „Bibliothek“.
„Die Peptide können kleine Taschen formen, in die
bestimmte Mini-Strukturen passen“, erklärt die Biologin. Dabei kann es
sich zum Beispiel um das Seltene-Erd-Element Terbium handeln. Bringt die
Forscherin ihre Bakteriophagen-Bibliothek mit einer solchen reinen
Terbium-Verbindung zusammen, die an einer festen Oberfläche hängt,
bleiben beim Abwaschen die Bakteriophagen hängen, in deren Peptid-Tasche
die Terbium-Verbindung recht gut passt.
Vermehren bis zur perfekten Passfähigkeit
In einem zweiten Durchgang verschärfen die Forscher
dann die Bedingungen, so dass nur noch die Bakteriophagen hängen
bleiben, in deren Peptid-Tasche die Terbium-Verbindung sehr gut passt.
Jetzt folgt eine Analyse des Abschnitts im Erbgut dieser Bakteriophagen,
der die Bauanleitung für das Peptid enthält. Nach dieser Bauanleitung
lässt Franziska Lederer dann die passenden Peptide für die
Terbium-Verbindung anfertigen.
Diese Peptide werden nun zum Beispiel an Partikel
aus einem magnetischen Material geheftet. Mischt man diese Teilchen mit
dem Leuchtpulver von Energiesparlampen in einer Brühe, dann heften sie
sich dort an die enthaltenen Terbium-Verbindungen. Anschließend fischen
die Forscher mit einem Magneten die Partikel samt den Seltenen Erden
wieder heraus. Nach dem Entfernen der Terbium-Verbindungen können die
Teilchen mit den Peptiden wieder zum Recyceln eingesetzt werden. „Mit
dieser Methode können wir spezifische Peptide für unterschiedliche
Seltene Erden, aber auch für wichtige Metalle wie Kupfer, Gold oder
verschiedene Platin-Metalle gewinnen und mit ihnen die jeweiligen
Substanzen aus sehr verdünnten und komplexen Gemischen extrahieren“,
erklärt Franziska Lederer.
Die Erfinder dieser Phagen-Display-Methode wurden
vor kurzem mit dem Nobelpreis für Chemie 2018 geehrt; lange vorher hatte
die Dresdner Nachwuchsgruppenleiterin die Bakteriophagen-Bibliotheken
aus der Gruppe des frisch gebackenen Nobelpreisträgers George Smith an
der amerikanischen University of Missouri erhalten. Da andere
Wissenschaftler die Phagen-Methode bisher nur für biologische Verfahren
wie der Herstellung von Antikörpern verwenden, leisten die HZDR-Forscher
beim Recyceln von Metallen echte Pionierarbeit.
Die spezifischen Peptide lassen sich auch an
Styropor-Kügelchen anheften. Mit der jeweiligen, gebundenen Substanz
schwimmen diese Kügelchen in einem Container an die Oberfläche des
Wassers und können einfach abgeschöpft werden. Mit solchen Methoden
könnten auch Erze aus den Abraumhalden von Bergwerken gewonnen werden,
in denen noch Spuren dieser Erze vorhanden sind.
„Vielleicht können wir auch Peptide isolieren, die
spezifisch bestimmte Kunststoffe binden“, überlegt Franziska Lederer.
Bisher werden Plastik-Abfälle nämlich häufig verfeuert, weil sie ein
Gemisch verschiedener Kunststoffe enthalten. Die Peptide der HZDR-Gruppe
aber könnten diese Abfall-Mischungen in Zukunft vielleicht sortieren
und so ein echtes Recycling einleiten. „Unsere Forschung steht noch am
Anfang und eine praktische Anwendung wird noch einige Zeit auf sich
warten lassen. Unser Ziel ist es, mit unserer innovativen
Technologieplattform das Recycling erheblich zu verbessern.“
_Publikation:
Robert Braun, Stefanie Bachmann, Nora
Schönberger, Sabine Matys, Franziska Lederer, Katrin Pollmann: „Peptides
as biosorbents – Promising tools for resource recovery“, Research in
Microbiology, DOI: 10.1016/j.resmic.2018.06.001 Link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29928986