Die Sommerferien stehen vor der Tür und damit für die meisten auch viel Freizeit. Kinder vor allem freuen sich – endlich mal wieder richtig Zeit zum Spielen.
PDF-Download: Hobbytipp Nr. 330
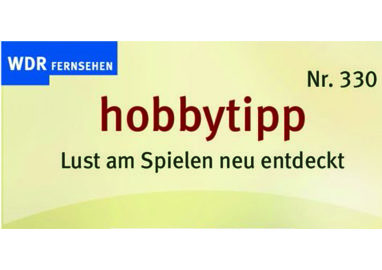
Die Sommerferien stehen vor der Tür und damit für die meisten auch viel Freizeit. Kinder vor allem freuen sich – endlich mal wieder richtig Zeit zum Spielen.
PDF-Download: Hobbytipp Nr. 330
Kiel/Dalhousie (pte012/21.12.2018/10:30) – In 60 Prozent der
Meeresschutzgebiete (MPAs) findet Schleppnetzfang statt. Das hat zum
Teil erheblich negative Auswirkungen auf dort lebende Arten. Zu diesem
Ergebnis kommt eine in "Science" publizierte Studie des GEOMAR
Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung Kiel http://geomar.de und der Dalhousie University http://dal.ca .
Vergleichbare Standards schaffen
Für die in "Science" publizierte Studie wurden mehr als 700 MPAs im
Bereich des Nordostatlantiks untersucht. Etwa 45 Prozent der deutschen
und fast 30 Prozent der europäischen Meeresgewässer sind als
Schutzgebiete ausgewiesen. Das bedeutet jedoch nicht, dass in diesen
Gebieten keinerlei Nutzung wie zum Beispiel durch Fischerei stattfindet.
In vielen der MPAs ist Schleppnetzfischerei erlaubt, die, laut den
Forschern, erhebliche negative Auswirkungen hat.
Das Team analysierte MPAs in Gewässern der Europäischen Union rund um
die Britischen Inseln, in der Nordsee, vor Frankreich und Spanien (ohne
Mittelmeer). Die Analyse von Satellitendaten ergab, dass die
Schleppnetzintensität in MPAs im Durchschnitt 40 Prozent höher war als
außerhalb der Schutzgebiete. "Wir zeigen, dass die Anzahl von
verschiedenen Hai- und Rochenarten in Gebieten mit hoher
Schleppnetzfischerei um bis 69 Prozent niedriger ist", betont Manuel
Dureuil, Hauptautor der Studie von der Dalhousie University. "Oft
handelt es sich hier um Grundschleppnetzfischerei, die auch für andere
Organismen negative Auswirkungen haben kann."
Grundschleppnetzfischerei beenden
"Unsere Studie zeigt, dass Meeresschutzgebiete mit
Grundschleppnetzfischerei keine sicheren Häfen sind, sondern gefährdete
Arten dort zum Teil stärker bedroht sind als außerhalb dieser Gebiete",
erläutert Rainer Froese, Co-Autor der Studie vom GEOMAR
Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel. "Damit Schutzgebiete ihren
Namen verdienen, muss die Grundschleppnetzfischerei beendet werden."
Laut dem Fischereibiologen bestehe auch keine Notwendigkeit einer
Befischung der MPAs. Wenn Fischbestände nachhaltig bewirtschaftet
würden, dann wachsen die Bestandsgrößen und die erlaubten Fänge können
leicht außerhalb von MPAs gefischt werden.
Die Wissenschaftler fordern daher, dass die Mindeststandards von MPAs
dringend verbessert werden. Die Politik müsse sich auf international
vergleichbare Standards unter Ausschluss der Grundschleppnetzfischerei
verständigen. Zusätzlich müsse das Management von MPAs gestärkt und
transparenter gestaltet werden. Nur so sei es möglich, dass
Meeresschutzgebiete langfristig zu einem nachhaltigen Schutz der
Meeresumwelt und bedrohter Arten beitragen werden.
Zugang zum Medizinstudium: Mehr Chancen für Talente
Die Kultusministerkonferenz hat sich auf einen Entwurf für
einen Staatsvertrag zur Reform der Zulassung zum Medizinstudiums verständigt.
Wissenschaftsministerin Theresia Bauer: Wir haben eine gute
Grundlage geschaffen, um die besten Bewerberinnen und Bewerber für den
Arztberuf auszuwählen
Die Kultusministerkonferenz (KMK) hat sich heute (6.
Dezember) über einen Entwurf für einen neuen Staatsvertrag zur Reform des
Medizinstudiums geeinigt. Künftig können bei der Vergabe von bis zu 70 Prozent
aller Studienplätze in Auswahlverfahren der Hochschulen vergeben werden, in
denen nicht nur die Abiturnote zählt. Die Wartezeit wird als Zugangskriterium
nach einer Übergangsphase von zwei Jahren abgeschafft. Außerdem neu ist die
Einführung einer zusätzlichen Eignungsquote, die Talenten, unabhängig von der
Abiturnote Chancen auf einen Studienplatz eröffnen. Baden-Württemberg hatte
gemeinsam mit Sachsen die Verhandlungsführung inne.
Wissenschaftsministerin Theresia Bauer: „Wie haben mit den
neuen Zugangsvoraussetzungen eine gute Grundlage geschaffen, um den am besten
geeigneten Bewerberinnen und Bewerbern für den Arztberuf das Medizinstudium zu
ermöglichen. Mit spezifischen Testverfahren, die das besondere Talent für das
Berufsbild prüfen, haben wir in Baden-Württemberg bereits langjährige und sehr
positive Erfahrungen gesammelt.“ Im Land sind insgesamt mehr als 2100
Studienanfängerplätze jährlich von der Neuregelung betroffen.
Übergangsregelung für Altwartende
Dem Staatsvertrag ging eine Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts (BVerfG ) voraus, wonach die Studienplätze vorrangig
nach Eignung eines Bewerbers zu vergeben sind. Die derzeitige Wartezeitquote,
die Wartesemester für diejenigen anrechnet, die nicht unmittelbar einen
Studienplatz erhalten haben, sei hingegen verfassungsrechtlich nicht geboten,
da sie gerade keine berufliche Eignung berücksichtige.
Die Kultusministerkonferenz hat entschieden, das Kriterium
„Wartezeit“ in den Jahren 2020 und 2021 übergangsweise im Rahmen der
zusätzlichen Eignungsquote noch eingeschränkt weiter zu berücksichtigen. In
Baden-Württemberg wird es sich während dieses Zeitraums um eine Kombination aus
Wartezeit, Eignungstest und berufspraktischer Erfahrung handeln.
Ausgleich unterschiedlicher Abiturdurchschnitte
Das Gericht hat dem Gesetzgeber darüber hinaus aufgetragen,
sicherzustellen, dass die Abiturnote im Auswahlverfahren der Hochschulen nicht
als alleiniges Kriterium herangezogen werden darf, weil sie einerseits nur
einen Teil der Eignungsanforderungen abbilde und das Abitur andererseits nicht
länderübergreifend vergleichbar sei. Deshalb seien auch schulnotenunabhängige
Kriterien zu berücksichtigen, etwa der Medizinertest, wie dies in
Baden-Württemberg bereits heute schon der Fall ist.
Der KMK liegt nun ein Entwurf eines Staatsvertrages vor, der
nicht nur die Monita des BVerfG ausräumt, sondern diesen auch weiterentwickelt.
Hierzu wurden die Quoten für den Zugang zum Studium neu geordnet.
Künftig werden die Bewerber für das Medizinstudium wie folgt
ausgewählt:
·30 % nach
Abiturbestenquote (Erhöhung um 10 %)
·10 % durch
eine zusätzliche Eignungsquote (nach schulnotenunabhängigen Kriterien)
·60 % durch
Auswahlverfahren der Hochschulen (Die Auswahl beinhaltet einen von den
Hochschulen festzulegenden Mix aus der Durchschnittsnote der
Hochschulzugangsberechtigung und schulnotenunabhängigen Kriterien)
·Durch
Landesrecht kann die zusätzliche Eignungsquote im Rahmen des Auswahlverfahrens
der Hochschulen erweitert werden. Diese Erweiterungsmöglichkeit bietet
Spielräume für eine chancenoffene und chancengerechte Weiterentwicklung.
Für die Abiturnote wird darüber hinaus ein Ausgleichsmechanismus
entwickelt, der eine annähernde Vergleichbarkeit unter den Ländern herstellt.
Spielräume nutzen, um die Allgemeinmedizin zu stärken
Baden-Württemberg wird die landesrechtlichen Spielräume
nutzen. „Das neue Verfahren eröffnet geeigneten und motivierten Bewerberinnen
und Bewerbern vielfältige Chancen auf einen Studienplatz. Es ermöglicht die
Auswahl einer Studierendenschaft, die den unterschiedlichen Anforderungen und
Fachrichtungen gerecht wird – in der Medizin etwa vom Praktischen Arzt bis zum
Forscher. Und es belässt uns die notwendigen Spielräume, flexibel auf
Weiterentwicklungen und Schwerpunktsetzungen zu reagieren. Ich denke hier
insbesondere an die Allgemeinmedizin“, sagt die Wissenschaftsministerin.
Neue Auswahlverfahren mittels Interviewtechniken
Aktuell prüft das Land mit den Universitäten, für einen
gewissen Teil der Studienplätze ein Interviewverfahren fortzuentwickeln, das
psychosoziale Kompetenzen der Bewerberinnen und Bewerber misst. Die
Wissenschaftsministerin sieht hierin eine große Chance, Studierende zu
gewinnen, die Fähigkeiten und Interesse für eine spätere Tätigkeit als
praktische Ärztin oder praktischer Arzt mitbringen. Sie sollen im Studium über
die neu geschaffenen Angebote in der Allgemeinmedizin verstärkt den Weg in
diese Fachrichtung finden.
„Ich halte dies für zielführender, als 17- bis 18-Jährige
noch vor Studienbeginn durch eine Landarztquote zu verpflichten, in etwa 15
Jahren einer bestimmten Tätigkeit nachzugehen“, ist sich Bauer sicher. „Wir kümmern
uns stattdessen besser darum, soziale und kommunikative Kompetenzen ausreichend
zu berücksichtigen und im Auswahlverfahren auch Studienschwerpunkten wie eben
der Allgemeinmedizin Rechnung zu tragen.“
Für die Chancengerechtigkeit sei es aber auch wichtig, dass
die verwendeten Kriterien immer wieder in Studien evaluiert würden.
Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg
Gendefekte verursachen neonatalen Diabetes, „MODY“ und „DIDMOAD-Wolfram-Syndrom“
Stuttgart – Eines von 89000 Kindern kommt in Deutschland bereits mit einer Diabetes-Erkrankung zur Welt. Dies ergab die jüngste Auswertung eines Patientenregisters, die Wissenschaftler im Rahmen der 45. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft vom 12. bis 15. Mai 2010 im Internationalen Congress Center Stuttgart vorstellen. Neben Diabetes Typ 1, der den Hauptteil an Diabetes-Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen ausmacht, gibt es auch Arten, die genetisch bedingt sind. Sie kommen zwar seltener vor, sind für die betroffenen kleinen Patienten aber mitunter lebensbedrohend. Experten diskutieren durch Gendefekte verursachte Diabetesarten in einem Symposium des diesjährigen Kongresses.
Das DPV-Register für Diabetes-Patienten-Verlaufsdokumentation enthält Daten zu mehr als 50000 Patienten, zusammengetragen von 299 Behandlungszentren in Deutschland und Österreich. Darunter waren neunzig Kinder, bei denen Ärzte in den ersten sechs Lebens-monaten eine Zuckerkrankheit feststellten. „In solchen Fällen spricht man von einem neonatalen Diabetes mellitus. Hier kann ein Gendefekt Ursache für eine Entwicklungsstörung der Bauch-speicheldrüse oder der dort beheimateten Beta-Zellen sein, die das Hormon Insulin produzieren“, berichtet Dr. med. Jürgen Grulich-Henn, Leiter des Bereiches Kinder-Diabetologie des Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Heidelberg. „Inzwischen sind einige Gendefekte bekannt und der Anteil der Erkrankungen, in denen wir eine Erklärung für den neonatalen Diabetes finden, ist gestiegen“, so Grulich-Henn.
Auch dem sogenannten MODY („Maturity Onset Diabetes of the Young“ oder „Erwachsenen-Diabetes mit Beginn im Jugendalter“) liegen definierte Gendefekte zugrunde. Diese führen zu einer gestörten Freisetzung des Insulins. Das klinische Bild ähnelt dem des Typ 2 Diabetes bei Erwachsenen, die Kinder sind aber in der Regel nicht übergewichtig. Es sind gegenwärtig mehr als sechs Gene mit insgesamt mehreren hundert Gendefekten beschrieben, die MODY verursachen. Meist sind mehrere Generationen in einer Familie betroffen. Die Klärung der Ursache hat auch hier unmittelbare Konsequenzen für die Kinder, da nicht alle MODY-Formen mit Insulin behandelt werden müssen.
Die Kenntnis der Gene ist sehr wichtig, da einige angeborene Diabeteserkrankungen auch andere Organe betreffen. Dr. med. Julia Rohayem, Funktions-Oberärztin Endokrinologie Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Carl Gustav Carus in Dresden, erläutert dies am Beispiel des „DIDMOAD-Wolfram-Syndroms“: „Der Gendefekt führt hier zum Ausfall des Proteins Wolframin, das im sogenannten endoplasmatischen Retikulum (ER) in allen Zellen des Körpers benötigt wird. Die Kinder erkranken im Vorschulalter in der Regel zunächst an der insulinabhängigen Zuckerkrankheit. Im Schulalter gesellt sich ein beidseitiger Verlust an Sehschärfe hinzu. Die betroffenen Patienten verlieren im weiteren Verlauf immmer mehr an Sehkraft, werden aber nicht vollständig blind“.
In etwa der Hälfte der Fälle wird durch den Ausfall des Wasserkonzentrations-Hormons aus dem Gehirn die Fähigkeit der Niere zur Urinkonzentration gestört (Diabetes insipidus centralis). Auch die Blasenentleerung kann beeinträchtigt sein. Das Hörvermögen fällt zunächst unbemerkt im Hochtonbereich aus, eine Schwerhörigkeit kann folgen. Derzeit sei die Lebenserwartung von Menschen mit „DIDMOAD” erheblich eingeschränkt, berichtet Rohayem. Mit der Entschlüsselung des Krankheitsmechanismus ist die Hoffnung verbunden, in der Zukunft Behandlungsmöglichkeiten für diese genetisch bedingte degenerative Erkrankung der Hormondrüsen und Nervenzellen zu entwickeln.
Duisburg/Essen (pte015/28.01.2019/13:42) – Forscher des Deutschen Krebskonsortiums (DKTK) http://dktk.dkfz.de an der Medizinischen Fakultät der Universität Duisburg-Essen (UDE) und
dem Universitätsklinikum Essen haben einen Biomarker entdeckt. Ohne
Gewebeentnahme ließen sich damit der Therapieerfolg und eventuelle
Rückfälle beim sogenannten Merkelzell-Karzinom, einem aggressiven
Hautkrebs, überwachen.
Bis zu 60 Prozent sprechen an
Häufig werden Merkelzell-Karzinome mit sogenannten
Immuncheckpoint-Hemmern therapiert. Diese Behandlungsmethode wurde 2018
mit dem Nobelpreis für Medizin ausgezeichnet und wird am
Universitätsklinikum Essen http://www.uniklinikum-essen.de erfolgreich eingesetzt. Etwa 40 bis 60 Prozent der Karzinome sprechen
auf die Therapie an, vor allem, wenn der Krebs erstmals auftritt. Falls
nicht, muss operiert und chemotherapiert werden.
"Wir haben deshalb nach einem Biomarker gesucht, mit dem die Tumorlast
während des gesamten Krankheitsverlaufs sicher bewertet werden kann", so
Jürgen C. Becker, Leiter der DKTK-Abteilung Translational Skin Cancer
Research im Zentrum für Medizinische Biotechnologie an der UDE http://www.uni-due.de . Nach langer Suche fanden die Forscher das Molekül cf miR-375, das von
Merkelzell-Tumorzellen übermäßig ins Blut freigesetzt wird.
Überaus nützliches Instrument
MicroRNAs wurden bereits als Biomarker, beispielsweise bei Darmkrebs und
Brustkrebs, anerkannt. "Wir hoffen, dass das künftig auch für miR-375
der Fall sein wird. In jedem Fall ist es ein nützliches Instrument, um
das Ansprechen auf die Therapie zu überwachen. Außerdem ermöglicht es
eine gezieltere Indikation für die PET/CT-Bildgebung", unterstreicht
Becker.
Joghurt, Kefir & Co. – Selber machen
Im Supermarkt ist die Vielfalt an Milchprodukten groß. Ganz einfach lassen sich viele davon auch in der eigenen Küche zubereiten. Der Aufwand wird mit dem natürlichen Geschmack belohnt.
Fans von frisch gezogenem Kefir bestellen „Kefirknöllchen“ im Internet, die neben verschiedenen Milchsäurebakterien auch Hefekulturen enthalten. Sie bauen den Milchzucker zu Kohlensäure und etwas Alkohol um. Man nehme: Ein Einmachglas mit Kefirknöllchen und zimmerwarmer Milch. Gut verschließen und bei Raumtemperatur an einen lichtgeschützten Ort aufstellen. Achten Sie dabei auf Sauberkeit und Hygiene. Nach ein bis zwei Tagen gießt man das fermentierte Getränk durch ein Plastiksieb in einen zweiten Behälter. Fertig ist der prickelnd-schäumende Kefir. Die Kulturen werden abgespült und können wiederverwendet werden.
Noch einfacher gelingt eine Art Buttermilch: Frische lauwarme Milch wird in einer Schüssel mit zwei Esslöffeln Essig oder Zitronensaft verrührt. Bereits nach 15 Minuten ist die Mischung dickflüssiger geworden und wird in ein Glas gefüllt. Mit einem Mulltuch abgedeckt ist die selbst gemachte Buttermilch im Kühlschrank rund eine Woche
haltbar.
Wer einmal selbst gemachten Joghurt probiert hat, schätzt den Unterschied zum gekauften Produkt. Ein Liter H-Milch wird auf rund 37 Grad Celsius erhitzt. Dann eine Messerspitze Milchsäurekulturen oder ein 200g-Becher Naturjogurt zugeben. Wenn Milch und Joghurt den gleichen Fettanteil haben, wird der Joghurt fester. Anschließend wird
umgerührt und die Mischung in kleine Gläschen gefüllt, die in einem Joghurtbereiter für 5-11 Stunden warm gehalten werden. Es darf nicht wärmer als 45 Grad sein, da die Bakterien sonst absterben. Zudem sollten Erschütterungen vermieden werden, um die Milchsäuregärung nicht zu stören. Wer keinen Joghurtbereiter hat, kann den Backofen
benutzen – auf 45 Grad aufheizen, die Gläschen in den Ofen stellen und den Ofen nach 15 Minuten abstellen.
Wenn der Joghurt fertig ist, kommt er in den Kühlschrank. Er lässt sich mit Saft, frischen Früchten oder etwas Honig aufpeppen. Besonders erfrischend schmeckt das türkische Joghurtgetränk Ayran. Dafür werden 400 ml Joghurt mit 200 ml kaltem Wasser und etwas Salz schaumig aufgeschlagen. Anschließend mit etwas Zitronensaft, Basilikum oder Kreuzkümmel abschmecken und eiskalt servieren. (aid)
aid: Infodienst für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Der gemeinnützige Verein löste sich 2016 auf.
Batterien laden, Straßen planen, Tablets programmieren: MINT
gestaltet unseren Alltag. Die passenden Studiengänge und
Ausbildungsberufe lernen Schülerinnen beim Girls‘ Day 2019 am
Donnerstag, 28. März 2019, am Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
kennen. Schülerinnen ab der fünften Klasse aller Schularten können dann
in Arbeitsfelder und Aufgaben in den MINT-Fächern Mathematik,
Informatik, Naturwissenschaft und Technik hineinschnuppern. In mehr als
40 Workshops, Führungen und Vorträgen informieren Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler am Campus Nord und am Campus Süd über
Berufsperspektiven.
„Wir wollen den Mädchen die
Vielfalt der Möglichkeiten im MINT-Bereich präsentieren“, erläutert
Sarah Wenz vom KIT, die die Aktivitäten am Girls Day koordiniert. „In
Workshops, Führung oder Vortrag bekommen sie Einblicke in faszinierende
Themenfelder.“ Jedes Jahr kommen mehr als 350 Schülerinnen aller
Schularten zwischen zehn und 18 Jahren ans KIT, um erste Einblicke in
Naturwissenschaft und Technik zu erhalten.
Am Campus Nord des
KIT starten die Teilnehmerinnen gemeinsam um 08:45 Uhr in den Girls‘
Day: Im Fortbildungszentrum für Technik und Umwelt
(Hermann-von-Helmholtz-Platz 1, 76344 Eggenstein-Leopoldshafen) können
sie sich über Studiengänge und Ausbildungsmöglichkeiten informieren. Ab
10:15 Uhr können die Schülerinnen dann in Workshops und im Labor
experimentieren, in den Materialwissenschaften auf Gold stoßen und aus
erster Hand erfahren, was eine Industriemechanikerin macht.
Am
Campus Süd beginnt der Girls’ Day um 09:00 Uhr im Foyer des
Tulla-Hörsaals (Englerstraße 11, Gebäude 11.40): An den Ständen finden
die Schülerinnen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner und können
sich über Studiengänge, Ausbildungsmöglichkeiten, Auslandsaufenthalte
und das MINT-Kolleg Baden-Württemberg informieren. Nach einer
Einführungsveranstaltung, bei der Frauen über Aufgaben und Erfahrungen
in ihren technischen und naturwissenschaftlichen Berufen und
Studiengängen berichten, beginnen ab 11:00 Uhr die Workshops. So können
die Mädchen hier die Welt der Humanoiden Robotik entdecken, sportliche
Bewegungen messen oder Schwingungen von schwankenden Hochhäusern bis
wackelnden Brücken untersuchen.
Eine vollständige Liste mit allen Angeboten des KIT findet sich auf www.girls-day.de.
Dort können sich die Schülerinnen für die Workshops anmelden – es sind
noch Plätze frei. Teilnehmerinnen werden für diesen Tag vom Unterricht
freigestellt und erhalten eine Teilnahmebescheinigung, die in der Schule
abgegeben werden kann.
Anmeldungen zum Girls Day am KIT unter: www.girls-day.de
Broschüre „Angebote für Schülerinnen, Schüler und Studieninteressierte“: https://www.sle.kit.edu/vorstudium/informationsbroschueren2_8002.php
Lebensstil eindeutig Krebsverursacher Nr. 1
Faktoren meist beeinflussbar, Umwelteinwirkung überschätzt
Rauchen: zehnmal krebserregender als Luftverschmutzung (Foto: Flickr/Roventine)
Sydney/Bern/Mailand (pte003/01.03.2012/06:10) – Mit dem Rauchen aufhören, Alkohol reduzieren, Übergewicht bekämpfen und Sonnenbrände vermeiden: Am besten schützt sich derjenige vor Krebs, der die bisherigen Empfehlungen zur Prävention berücksichtigt. Andere diskutierte Faktoren wie Chemikalien in Nahrung oder Produkten haben im Vergleich zum Lebensstil kaum Einfluss, berichten Forscher der University of New South Wales http://unsw.edu.au in der Zeitschrift "The Lancet Oncology".
Verzerrte Darstellung
Studienleiter Bernard Stewart überprüfte die bisherige Studienlage zu Tumorrisiken. "Krebs ist in der westlichen Welt die meistgefürchtete Krankheit, und die meisten Menschen können dank der häufigen Thematisierung in den Medien gleich eine Vielzahl von Krebsursachen nennen. Viele Gefahren werden jedoch deutlich überproportional dargestellt", so der australische Forscher.
So gibt es beispielsweise Belege dafür, dass Luftverschmutzung zu Krebs beiträgt, doch macht diese Gefährdung nur ein Zehntel von jener des Rauchens aus. Auch kommt man durch verunreinigte Nahrungsmitteln oder bestimmte Konsumprodukte sehr wohl in Kontakt mit kleinsten Mengen karzinogener Chemikalien. Doch: "In Industrieländern wurde bisher noch nicht bewiesen, dass diese Faktoren Krebs auslösen", so Stewart.
Giftiger Rauch
"Die wichtigsten beeinflussbaren Risikofaktoren für Krebs sind allen voran das Rauchen, sowie Übergewicht, Alkohol, UV-Licht und ungünstige Ernährungsgewohnheiten", sagt Rolf Marti, Leiter des wissenschaftlichen Sekretariats der Krebsliga Schweiz http://krebsliga.ch , im pressetext-Interview. Die wichtigsten, nicht beeinflussbaren Faktoren sind das Alter – zwei Drittel der Tumorerkrankungen treten erst nach dem 60. Lebensjahr auf – sowie genetische Prädispositionen. "Umweltfaktoren werden allgemein meist überschätzt", bestätigt auch Marti.
Weniger Todesfälle
Für die Prävention in der EU stellen italienische und Schweizer Epidemiologen um Matteo Malvezzi in den "Annals of Oncology" ein gutes Zeugnis aus: Das ursprüngliche Ziel von 2003, die Zahl der Krebs-Todesfälle bis 2015 um 15 Prozent zu senken, dürfte schon im laufenden Jahr erreicht werden. Rund 1,3 Mio. EU-Bürger werden 2012 an Krebs sterben, so die vorläufige Schätzung. Bei Männern sind das um zehn, bei Frauen um sieben Prozent weniger als 2007.
Die Forscher führen dies vor allem auf einen Rückgang des Rauchens der Männer, auf weitere Präventionsmaßnahmen sowie auf Früherkennung und bessere Tumorbehandlung zurück. Die sinkende Mortalität hat einen Schönheitsfehler: Die Zahl neuer Krebserkrankungen nimmt zu, und in einzelnen Arten wie etwa Bauchspeicheldrüsenkrebs steigen die Todesfälle. Letzteres gilt auch für Lungenkrebs-Tode bei Frauen, die seit 2007 um 13,44 Prozent zunahmen. Bei Brustkrebs sank die Quote um neun und für unter 50-Jährige sogar um 13 Prozent.
Links zu den Studienabstracts: http://bit.ly/zk0zmo und http://bit.ly/zCm6Ef
Nach Anlaufzeit immer mehr Produkte auf dem Markt
Rund 70 Vertreter von Erzeugern, Handel, Futtermittelindustrie, Verbraucherverbänden und Politik kamen Mitte September auf Einladung der SPD-Bundestagsfraktion in Berlin zusammen, um sich über erste Erfahrungen mit der neuen „ohne Gentechnik“- Kennzeichnung und mögliche Strategien darüber auszutauschen, wie man ihre Nutzung besser voranbringen kann. Die Teilnehmer zeigten sich davon überzeugt, dass die Nachfrage im „ohne Gentechnik“-Marktsektor groß sein wird – wenn ein entsprechend großes und breit gefächertes Angebot zur Verfügung steht. Deutlich wurde auch, dass die Unternehmen Anlaufzeit für den Umstieg auf gentechnikfreie Futterpflanzen brauchen, denn die diesjährige Ernte war bereits verplant, als die Kennzeichnungsregelung in Kraft trat.
Ein Problem ist auch die dürftige Informationslage sowohl bei Verbrauchern als auch Anwendern. Hinzu kommt das Fehlen eines einheitlichen Labels. Unsicherheiten darüber, wie die Lebensmittelüberwachung auf Funde von Spuren gentechnisch veränderten Materials reagiert, scheinen inzwischen ausgeräumt zu sein. Nach Absprache mit dem Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz scheint die Überwachung in den Ländern den Umgang mit zufälligen oder technisch unvermeidbaren gentechnisch veränderten Organismen einheitlich handhaben zu können. Auch wurde von den anwesenden Experten aus dem Futtermittelbereich erklärt, dass genügend GVO-freie Futtermittel zur Verfügung stünden. Dass „ohne Gentechnik“ machbar ist, zeigten die Berichte von Erzeugern und Anbietern, die bereits in die Kennzeichnung eingestiegen sind.
So hat sich zum Beispiel in der so genannten „Spätzle-Connection“ eine gesamte Produktionskette – vom Futtermittel über die Eiererzeugung bis zum Endprodukt – zusammengetan, damit Deutschlands zweitgrößter Teigwaren-Hersteller Alb-Gold sämtliche Produkte „ohne Gentechnik“ anbieten kann. Die mittelständische Supermarktkette tegut, die bereits 2005 mit der Einführung von Milchprodukten „ohne Gentechnik“ gestartet ist, ergänzt dies ab 1. Oktober 2008 mit Schweinefleisch der Eigenmarke „kff LandPrimus“. Noch beäugen sich die Großen der Branche skeptisch: Wer kommt zuerst raus? Damit ist wohl schneller zu rechnen, als manche derzeit glauben. Der Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde (BLL) sieht das deutlich skeptischer: „Die Vorgaben dieser neuen „ohne Gentechnik“-Kennzeichnung finden in der Ernährungsindustrie und im Lebensmitteleinzelhandel bislang keine Akzeptanz“, meint Dr. Marcus Girnau, Geschäftsführer des BLL. Eine Ausnahme bildeten lediglich Nischenmärkte.
Die SPD forderte nach der Veranstaltung eine Informationskampagne für den Handel, um bestehende Unsicherheiten über die Konsequenzen der neuen Kennzeichnung und die Handhabung durch die Lebensmittelüberwachung auszuräumen. Geld hierfür wolle man im Rahmen der anstehenden Haushaltsberatungen locker machen. aid, Britta Klein
aid: Infodienst für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Der gemeinnützige Verein löste sich 2016 auf.
fzm – Wer am Wochenende zu einem Waldspaziergang aufbricht, erwartet
dort Erholung in der heimischen Flora und kann, wenn er Glück hat,
einige Exemplare der einheimischen Fauna erspähen. Er ist sich
vielleicht auch der Risiken bewusst, die durch Zeckenbisse oder den
Verzehr einiger Pilzarten drohen. Niemand rechnet jedoch damit, sich
mit einer exotischen Erkrankung zu infizieren, die von einem Bakterium
ausgelöst wird, das erst vor wenigen Jahren entdeckt wurde. Doch genau
dies ist möglich. Wie eine Expertengruppe um Prof. Rüdiger Braun,
Stuttgart, in der DMW Deutsche Medizinische Wochenschrift (Georg Thieme
Verlag, Stuttgart, 2005) berichtet, wurde im Jahr 2001 im Schönbuch,
einem beliebten Naherholungsgebiet bei Stuttgart, ein Bakterium
entdeckt, das bei Hirschen und Rehen zu Fieber und eitrigen
Erkrankungen des Fells führt. Nach seinem Entdeckungsort wurde der
Erreger Bartonella schoenbuchensis genannt, und gehört damit zu einer
Bakterienart, die auch beim Menschen sehr ungewöhnliche Krankheiten
verursacht. Dazu gehört etwa die Peruwarze (Verruga peruviana). Sie
wird von B. bacilliformis ausgelöst und ist in Südamerika verbreitet.
Überträger ist eine bestimmte Sandmücke, die nur in den nördlichen
Anden in Höhen zwischen 1000 und 3000 Metern verbreitet ist. B.
bacilliformis kann auch das tödliche Oroya-Fieber auslösen. Eine andere
exotische „Bartonellose“ ist das Wolhynische Fieber, benannt nach einer
heute zur Ukraine gehörenden Region, in der im Ersten Weltkrieg die
Kriegsfront verlief. In den Schützengräber grassierte damals eine
hochfiebrige Erkrankung, die vielen Soldaten das Leben kostete.
Auslöser war B. quintana. Überträger waren Wühlmäuse. Das Wolhynische
Fieber gibt es heute noch: Nach Angaben Prof. Brauns tritt es
gelegentlich im Obdachlosenmilieu von Großstädten auf.Des weiteren sind
Bartonellen die Auslöser der Katzenkratzkrankheit, einer
Lymphknotenschwellung nach einer Kratzverletzung durch eine infizierte
Hauskatze.Könnte nicht auch B. schoenbuchensis Menschen infizieren?
Dies wurde lange vermutet, konnte aber erst kürzlich bewiesen werden,
wie Prof. Braun erläutert. Die Gefahr bestehe nach einem Stich der
Hirschlausfliege. Das 5-6 mm lange braune Insekt ist der Überträger von
B. schoenbuchensis. Nach dem Stich kann es – ähnlich wie im Fell des
Rotwilds – zur Bildung von Pusteln auf der Haut kommen. Ob die
Bakterien weitere Schäden im Körper anrichten, ist unbekannt. Prof.
Braun schließt dies mit Blick auf die anderen Erkrankungen jedoch nicht
aus. Denkbar sei sogar ein Befall der Herzklappen (Endokarditis).
Gefährdet ist jedoch weniger der gelegentliche Spaziergänger als
vielmehr Personen, die beruflich im Wald tätig sind, etwa Förster. Bei
ihnen sollten Ärzte deshalb bei unklaren Erkrankungen auch an die
Möglichkeit einer exotischen Infektion mit dem erst kürzlich entdeckten
Erreger denken und entsprechende Tests durchführen, rät der Kollege
Prof. Braun.D. Hassler.
Deutsche Medizinische Wochenschrift 2005; 130 (1/2): 13 Weitere Themen in der DMW 1/2: