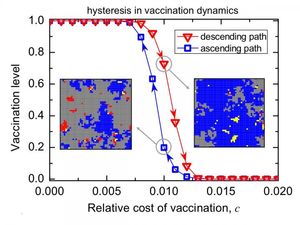Innere "Bürste" bekämpft Lungenkrankheiten
Versagen von Schleim spielt bei Mukoviszidose entscheidende Rolle
Lunge: bleibende Schleimansammlungen machen krank (Foto: SPL)
Chapel Hill (pte012/24.08.2012/10:00) – Wissenschaftler der University of North Carolina http://northcarolina.edu haben laut eigenen Angaben eine "innere Bürste" identifiziert, die dabei hilft, die Lungen von unerwünschten Substanzen zu befreien. Diese Entdeckung soll dem Team um Michael Rubinstein helfen, mehr über Lungenerkrankungen zu erfahren. Diese bürstenähnliche Schicht sondert einen klebrigen Schleim ab und damit die Fremdkörper. Diese Entdeckung könnte helfen zu verstehen, was bei Mukoviszidose, Asthma und ähnlichen Leiden genau im Körper der Patienten geschieht.
Schutz vor eingeatmeter Luft
Der Schleim hilft, die eingeatmeten Schadstoffe einzusammeln und ist vergleichbar mit einer "rinnenden Nase", die Husten mit Auswurf produziert. Bis heute gingen die meisten Experten davon aus, dass eine wasserähnliche Substanz zur Trennung des Schleims von den die Luftwege auskleidenden Zellen diente. Das passte jedoch nicht dazu, dass dieser Schleim in seiner eigenen charakteristischen Schicht verblieb. Die Wissenschaftler nutzen bildgebende Verfahren, um herauszufinden, was in den Lungen genau vor sich geht.
Den Forschern gelang es, ein Bronchialepithelzellen sichtbar zu machen. Die bürstenähnliche Schicht besteht aus schützenden Molekülen, die den klebrigen Schleim daran hindern, die Flimmerhärchen und die Epithelzellen zu erreichen und damit einen normalen Transport des Schleims zu gewährleisten. Laut Rubinstein ist die eingeatmete Luft nicht unbedingt sauber und der Mensch mit jedem Atemzug viele schädliche Substanzen in den Körper aufnimmt. "Wir brauchen einen Mechanismus, der den ganzen Müll, den wir einatmen, entfernt. Das geschieht mit Hilfe eines klebrigen Gels, sprich Schleims, der diese Partikel aufnimmt und mit Hilfe der Flimmerhärchen wieder entfernt."
Flimmerhärchen-Ausfall problematisch
Flimmerhärchen sind immer aktiv, auch wenn der Mensch schläft. "Sie entfernen in einem koordinierten Ablauf, den mit den Fremdkörpern angereicherten Schleim aus den Lungen, der in der Folge entweder geschluckt oder ausgespuckt wird. Sie vibrieren auch noch einige Stunden nach dem Tod. Würden sie ihre Funktion einstellen, sammelten sich große Mengen an Schleim an, die einen idealen Nährboden für Bakterien darstellen." Laut den Wissenschaftlern schützt diese "Bürstenschicht" die Zellen vor dem klebrigen Schleim und fungiert damit als zweite Barriere gegen Viren oder Bakterien, die versuchen in den Schleim einzudringen.
Bei Krankheiten wie Mukoviszidose oder einer chronisch obstruktiven Lungenkrankheit funktioniert diese "Bürste" nicht mehr richtig. Die Wissenschaftler gehen davon aus, dass sie zerdrückt werden und den Schleim nicht mehr transportieren, der sich dann an den Zellen ablagert. Laut Rubinstein kann das Versagen dieser Bürste zu einer unbeweglichen Ansammlung von Schleim führen, die in der Folge für Infektionen, Entzündungen und schließlich für eine Zerstörung des Lungengewebes und damit der Organfunktion verantwortlich ist.