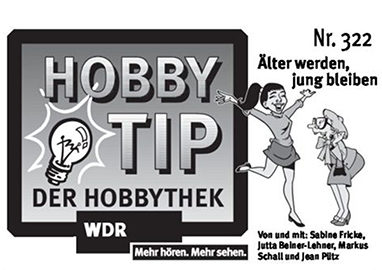02
| 2019 – Tragbare Augmented-Reality – näher zur Realität durch Kombination aus
hocheffizienter Durchsichtoptik und extrem stromsparender
OLED-Mikrodisplay-Technologie
LetinAR, ein koreanisches Start-up-Unternehmen,
das eine Optiklösung für Augmented-reality (AR)-Brillen entwickelt, und
Fraunhofer FEP als deutscher Spezialist für die kundenspezifische Entwicklung
von OLED-Mikrodisplays für Wearables, präsentieren gemeinsam die Zukunft der
AR-Brillentechnologie durch ihren ersten gemeinsamen Demonstrator des
PinMR™-Linsensets mit ultra-low-power OLED-Mikrodisplay auf dem Mobile World
Congress (MWC) in Barcelona, Spanien, vom 25. bis 28. Februar 2019, am Stand
Nr. CS80 (Hall Congress Square).
dazu notwendige Technik durchdringt immer mehr Lebensbereiche. Selbst in
Spielzeugen wird AR inzwischen eingeführt und lässt virtuelle Welten über
entsprechende Endgeräte auf Spielteppichen entstehen oder die altbewährte
Spielzeugeisenbahn virtuell über den Schienen in heutigen Kinderzimmern fahren.
In der Industrie ist AR bereits angekommen – immer mehr Unternehmen werden in
Zukunft für ein breites Anwendungsspektrum auf AR-Lösungen setzen. Bei großen
Logistikunternehmen und Autobauern gehören Wearables zur Anzeige von
Produktionsdaten oder Lagerplätzen bereits zum Inventar und Arbeitsalltag.
Diverse tragbare Endgeräte in Form von Datenbrillen oder anderen
Anzeigelösungen am Kopf oder Körper des Arbeiters in der Logistik oder an der
Produktionsstrecke sind bereits am Markt.
Dennoch ist man gerade für die bedienerfreundliche Brillenlösung, welche das
Arbeiten mit freien Händen und ohne Ändern des Blickfokus weg vom Arbeitsobjekt
ermöglicht, noch immer mit Hürden konfrontiert. Den derzeit erhältlichen
AR-Brillen mangelt es noch immer an entscheidenden Parametern, die zur
Nutzerfreundlichkeit und Ergonomie für den langfristigen Einsatz am Menschen
nötig sind. Formfaktor, überdimensionale "Boxen" vor dem Gesicht
aufgrund aufwändiger Optikelemente und Displays, ein enges Sichtfeld, kurze
Akkulaufzeiten, komplizierte und teure Produktionsprozesse und ungenaue
Farbauflösung sind einige der wichtigsten Fakten, die den Durchbruch der
AR-Brille verzögern.
LetinAR ist ein koreanisches Startup-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung
neuartiger Optiken für AR-Brillen spezialisiert hat. Die
PinMR™-Technologie von LetinAR wird neue Maßstäbe bei der Herstellung dieser
Wearables setzen. Sie haben den sogenannten "Pinhole-Effekt" auf
kleinste Spiegel angewendet und diese in Brillengläser integriert. Dieser PinMR
™ reflektiert das von einem Mikrodisplay erzeugte Licht und leitet es in die
menschliche Pupille. Der Benutzer kann das über ein Mikrodisplay mit
vergrößernder Durchsichtoptik erzeugte virtuelle Bild sowie das Bild aus der
realen Welt bequem betrachten. Das menschliche Auge kann die Spiegel, die
kleiner als die Pupillen sind, nicht erkennen. Nur das virtuelle Bild, welches
durch das von diesen Spiegeln reflektierte Licht entsteht, ist sichtbar.
Diese speziell entwickelte Pin-Spiegel-Optik (PinMR™) wurde nun mit der
OLED-Mikrodisplay-Technologie des Fraunhofer FEP kombiniert, die für ihren
extrem geringen Stromverbrauch bekannt ist. Die extrem kleine Größe des sehr
stromsparenden OLED-Mikrodisplays eignet sich perfekt für kleine,
miniaturisierte und leichte Systeme, die tragbar und einfach in Brille, Kappe
oder Helm zu integrieren sind. Die OLED-Technologie des Displays ermöglicht
scharfe Bilder mit sehr hohen Kontrasten und Helligkeit über einen sehr weiten
Dynamikbereich (bisher monochromes Grün, aber grundsätzlich erweiterbar bis
Vollfarbe). Darüber hinaus ermöglicht ein zusätzliches, innovatives
Bluetooth-Konzept nun eine energiesparende Kommunikation mit dem
Wearable/Display. Die Datenübertragung von z.B. Scannerdaten an Lagerorte oder
Füllstände kann in der Logistik direkt an die AR-Brille eines Kommissionierers
übertragen werden. Und das ohne die Schicht für Ladezeiten der Brille
unterbrechen zu müssen.
Jeonghun Ha, CTO bei LetinAR, sagt: "Es ist eine Ehre, mit dem Fraunhofer
FEP als weltweit renommierten Spezialisten für die kundenspezifische
Entwicklung von OLED-Mikrodisplays, zusammenzuarbeiten", und "Die
Zusammenarbeit zwischen LetinAR und Fraunhofer FEP wird die technischen
Barrieren abbauen, die den Durchbruch von Augmented-Reality (AR)-Brillen lange
Zeit behindert haben. LetinAR und Fraunhofer FEP freuen sich darauf, die
Zusammenarbeit für weitere AR-Anwendungen auszuweiten."
Dr. Uwe Vogel, Bereichsleiter Mikrodisplays und Sensoren am Fraunhofer FEP,
erklärt die Vorteile: „Wir freuen uns sehr, einen weltweit ersten Demonstrator
mit der vielversprechenden PinMR™ Optik von LetinAR gemeinsam mit unseren
ultra-low-power Mikrodisplays in Barcelona vorstellen zu können. Die Zusammenarbeit
zeigt, was unsere Technologie in Kombination mit der neuesten Technologie der
Optikspezialisten von LetinAR hervorbringen kann. Diese Verschmelzung von
Technologien wird hoffentlich bald zu extrem kleinen, leichten und
elektrooptisch effizienten Bauelementen für Datenbrillen und anderen Wearables
führen, die eine deutlich verbesserte Akkulaufzeit und reduzierte Ladezyklen
ermöglichen und damit immer einsatzbereit sind, wie beispielsweise die heutigen
Smartphones, mit denen sie sich drahtlos verbinden können."
Der Demonstrator überzeugt durch eine sehr hohe optische Effizienz der
LetinAR-Technologie, derzeit ist am Markt keine vergleichbar effiziente
Durchsichtoptik am Markt erhältlich. Gemeinsam mit den extrem kleinen
OLED-Mikrodisplays stellen die Wissenschaftler ein System vor, das künftige
AR-Brillen einen großen Schritt voranbringen kann – ergonomische und
platzsparende Designs rücken in greifbare Nähe. Auch die einfache Steuerbarkeit
von OLED-Mikrodisplays punktet bei Systementwicklern. Insgesamt kann die
Kombination der beiden Technologien einige der aktuellen Hürden überwinden und
neuen AR-Wearables den Weg in den täglichen Einsatz ebnen. Künftig wollen die
Entwickler beider Einrichtungen die vorgestellten Technologien gemeinsam mit
Herstellern für die AR-Systeme und Wearables der Zukunft kundenspezifisch
voranbringen.
Zur Vorstellung der Konzepte und für Diskussionen zu möglichen
Technologieentwicklungen und -transfers stellen beide Einrichtungen einen
ersten gemeinsamen Technologiedemonstrator der hocheffizienten
Durchsichtoptiken mit den OLED-Mikrodisplays auf dem Mobile World Congress
2019, in Barcelona, Spanien am Stand von LetinAR, Nr. CS80 (Hall Congress Square)
vor.
Das LetinAR-Team wird ebenfalls einen
Einblick in den AR-Markt- und Technologietrends geben. Jaehyeok Kim, CEO von
LetinAR, wird die den Beitrag zum Thema “Why can’t we have true Augmented
Reality glasses, yet?: Bold suggestion to tackle the AR optics problem” am 25. Februar 2019 von 10:30 – 11:30 Uhr in CC4.2, 4G30,
Halle 4 präsentieren. Die Teilnehmer können den Datenbrille-Demo von
LetinAR PinMR™ auf der Konferenz erleben. Private Meetings, Konferenztermine
und Pressegespräche können unter https://letinar.com. gebucht werden.
Über LetinAR (www.letinar.com):
LetinAR mit Sitz in Seoul/Südkorea konzentriert sich auf die Entwicklung
optischer Systeme für Augmented Reality (AR) Datenbrillen. LetinAR hat den
sogenannten "Pinhole-Effekt" auf winzige Spiegel angewendet und prägt
den neuen Begriff "PinMR™". Ziel ist es, traditionelle optische
AR-Systeme wie Halbspiegel, diffraktive optische Elemente (DOEs) und
Wellenleiter durch eine eigene, markengeschützte PinMR™-Technologie zu
ersetzen.
LetinAR plant, PinMR™ Linsen als komplettes Modul zu liefern, das aus PinMR™
Linsen und einem Mikrodisplay von externen Partnern besteht. LetinAR wird Ende
2019 damit beginnen, PinMR™ Linsenmuster für einige Kunden bereitzustellen, was
es den Herstellern von Datenbrillen ermöglicht, das Verwendungspotenzial von
PinMR™ Linsen für ihre eigenen Produkte zu bewerten.
LetinAR hat 700.000 $ Startkapital von Naver, der größten Portalseite und
Suchmaschinenbetreiber in Südkorea, gesammelt. LetinAR erhielt anschließend 5,4
Millionen Dollar in der Serie A von einem anderen Internet-Riesen, Kakao
Ventures, KB Investment, Naver als Nachfolger und drei weiteren koreanischen
VCs.
Über das Fraunhofer FEP (www.fep.fraunhofer.de):
Das Fraunhofer-Institut für Organische Elektronik, Elektronenstrahl- und
Plasmatechnik FEP mit Sitz in Dresden beschäftigt sich mit der Entwicklung
innovativer Lösungen, Technologien und Verfahren zur Oberflächenmodifikation
und organischen Elektronik.
Neben der langjährigen Erfahrung in der Elektronenstrahl- und Plasmatechnologie
ist das Fraunhofer FEP der führender unabhängiger Forschungs- und Entwicklungsdienstleister,
der die organische Elektronik dem Design und der Prozessintegration von
Silizium-CMOS-Integrierten Schaltungen (ICs) kombiniert. Ziel ist es, die
Ergebnisse von Forschung und Entwicklung im Bereich kombinierter
Silizium-Organik mikroelektronischer Bauelemente in die Produktion zu
übertragen, indem man sich auf spezifische Prozessentwicklung, Komponenten,
Systemintegration und Anwendungen auf Basis der OLED-auf-Silizium-Technologie
konzentriert.
Daher suchen wir kontinuierlich nach Partnern für Weiterentwicklung und
Kommerzialisierung Fraunhofer FEP‘s fundierter Erfahrungen in der Entwicklung
einzigartiger OLED-Mikrodisplay-Architekturen, wie großflächige
OLED-Mikrodisplays für VR, ultra-low power, low-latency und bidirektionale Mikrodisplays,
die Bildanzeige mit eingebetteter Bildsensorik für AR kombinieren, oder die
Mikrostrukturierung für verbesserte Energieeffizienz und Farbe von
RGB-OLED-Displays belegen. Darüber hinaus wird die Technologie- und
Designkompetenz auch auf optoelektronische Sensorlösungen angewandt, die
Silizium-CMOS-basierte und/oder organische Photodetektoren (OPD) und
eingebettete Beleuchtung für interaktiven optischen Fingerabdruck- oder
Oberflächentopologie-Bildsensoren, Single-Chip-Reflexionslichtschranken, optische
Sensoren mit eingebetteter Beleuchtung (z. B. Neigungs-, Streulicht-,
Wellenfrontsensoren), Lab-on-Chip-Module mit eingebetteter Mikrofluidik oder
Bio- und Umweltüberwachung nutzen.