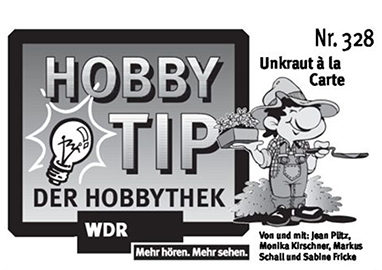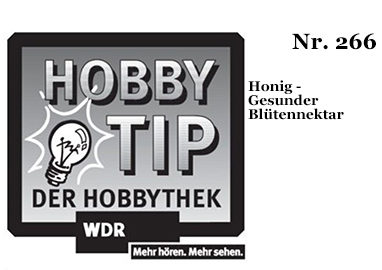Unfruchtbarkeit, Impotenz, Damenbart und Akne
Die dunklen Seiten der Anabolika
Bochum – Testosteron
und seine Abkömmlinge, die anabolen androgenen Steroide (AAS), fördern
nicht nur den Aufbau der Muskeln, sondern angeblich auch die sexuelle
Leistungsfähigkeit von Männern und Frauen. Das jedenfalls versprechen
viele Anbieter von Anabolika im Internet. Sie verschweigen dabei, dass
Anabolika negative Auswirkungen auf Potenz und Sexualleben haben können.
Auch die Hoffnung auf einen schöneren Körper kann schnell enttäuscht
werden, wenn sich unter hohen Dosierungen gefährliche Nebenwirkungen
entwickeln, warnen Experten der Deutschen Gesellschaft für
Endokrinologie (DGE) im European Journal of Endocrinology.
Testosteron
wird natürlicherweise im Hoden gebildet und fördert nicht nur die
Bildung der Spermien, sondern ist auch für die Ausbildung und Erhaltung
des männlichen Körpers verantwortlich. Wird das Hormon oder eines seiner
Varianten von außen zugeführt, kann dies schnell die gegenteilige
Wirkung haben. „Ab einer gewissen Dosis wird die Spermienbildung so weit
gedrosselt, dass die Männer unfruchtbar werden“, erklärt Professor Dr.
med. Dr. h. c. Eberhard Nieschlag. „Testosteron ist deshalb sogar als
Verhütungsmittel für den Mann in der Diskussion“, fügt der ehemalige
Direktor des heutigen Centrums für Reproduktionsmedizin und Andrologie
am Universitätsklinikum Münster hinzu, der als Spezialist im Einsatz von
Testosteron bei Erkrankungen mit Unterfunktion der Hoden gilt.
Einen
chronischen Missbrauch des Hormons kann der international renommierte
Experte manchmal an der Größe der Hoden erkennen. „Da 95 Prozent des
Hodens aus den Samenkanälchen bestehen, tritt mit dem Mangel an Spermien
auch ein Schrumpfungsprozess der Hoden ein“, erklärt Professor
Nieschlag. Betroffen sind aber nicht nur die Hoden. Bei einigen
Anabolika-Anwendern komme es auch zu einem Verlust von Libido und
Erektionsfähigkeit. Der Endokrinologe erklärt dies mit der
Verstoffwechselung einiger Anabolika zu Östrogenen. Ein Überschuss
dieser weiblichen Hormone kann dazu führen, dass nicht nur die Muskeln
wachsen, sondern sich auch eine weibliche Brust (Gynäkomastie genannt)
bildet.
Auch
bei Frauen ist die regelmäßige Einnahme von muskelfördernden AAS häufig
mit Störungen der Fruchtbarkeit verbunden. „Zyklusstörungen oder ein
längeres Ausbleiben der Menstruation sind eine häufige Folge des
Anabolikakonsums“, berichtet Dr. med. Elena Vorona vom Zentrum für
Endokrinologie, Diabetologie und Rheumatologie in Dortmund. Starke
sportliche Aktivität aber auch Essstörungen können die Fruchtbarkeit
weiter beeinträchtigen, erklärt die Mitautorin des Fachartikels. Der
Einfluss der einzelnen Faktoren sei für Reproduktionsmediziner häufig
schwer voneinander zu trennen. Auffällig sei aber, dass sportliche
Frauen mit Anabolikamissbrauch oft die geringsten Chancen auf eine
Schwangerschaft haben.
Äußerst
störend sind für viele Frauen auch die Auswirkungen von Anabolika auf
die Haut. Die vermehrte Talgproduktion führt zu einer fettigen Haut, die
zur Akne neigt. Viele Frauen leiden auch darunter, dass Anabolika
Bartwuchs fördern. Gleichzeitig komme es zum vermehrten Ausfall der
Haupthaare. Auch eine Verkleinerung der Brüste könne das Selbstbild
vieler Frauen stören. Die meisten dieser Wirkungen bilden sich nach dem
Absetzen der Hormone zurück, erklärt die Expertin. Eine Vertiefung der
Stimme, die auf einer Vergrößerung des Kehlkopfs beruht, bleibe
allerdings bestehen.
Andere
Risiken, die Androgenen häufig nachgesagt werden, haben sich in Studien
nicht bestätigt. Die Anabolika führten weder zur Vergrößerung der
Prostata noch kommt es hier häufiger zum Auftreten neuer
Krebserkrankungen. Auch bei Frauen, welche Androgene zum Doping
zugeführt haben, gebe es keinen Hinweis auf ein erhöhtes
Brustkrebsrisiko. Es kann jedoch zu schweren Schädigungen von Leber,
Herz und Psyche kommen, berichtet DGE-Mediensprecher Professor Dr. med.
Dr. h. c. Helmut Schatz, Bochum: „In den Händen eines versierten Arztes
sind Testosteron-Präparate ein sicheres Medikament. Die Einsatzgebiete
reichen von der gezielten Einleitung der Pubertät bei
Entwicklungsstörungen von Knaben bis zur gezielten Behandlung des
Androgenmangels im Alter.“