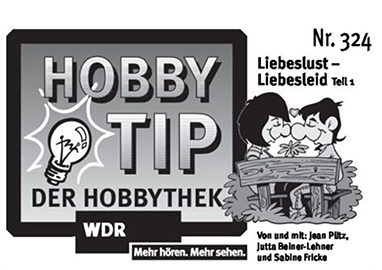ForscherInnen sind weltweit einem uralten Rätsel auf der Spur: Was passiert im Gehirn, wenn das Herz still steht? Wiener MedizinerInnen arbeiten mithilfe des
Wissenschaftsfonds FWF an einer internationalen Studie mit, die Gedächtnisprozesse bei Herzstillstand untersucht.
Wie lernen wir Sprachen, wie entstehen Gefühle und was passiert, wenn wir schlafen?
Auf viele dieser hoch komplexen Fragen hat die Hirnforschung mithilfe
moderner Methoden heute Antworten parat. Die ForscherInnen können die
Funktionsweise des Gehirns immer besser erklären und damit wichtige
Therapiefortschritte bei neurologischen Erkrankungen wie
Schlafstörungen, Migräne, Schlaganfall oder Demenz erzielen. Und dennoch
bleibt vieles offen und manches auch umstritten, wenn es um kognitive
Fähigkeiten und damit verbunden schwer fassbare Begriffe wie
Wahrnehmung, Bewusstsein oder Geist geht.
GROßEN RÄTSELN AUF DER SPUR
Ein Forschungsprojekt des Wissenschaftsfonds FWF will nun wissenschaftliche
Fakten zu einem dieser noch immer ungelösten Rätsel liefern: Was
passiert im Gehirn, wenn Menschen durch einen Herzstillstand an der
Schwelle zum Tod stehen und nach ihrer Reanimation von Erinnerungen aus
der Zeit des Herzstillstandes berichten? Diese äußerst seltenen, aber
doch immer wieder auftretenden Berichte sind aus Sicht der Wissenschaft
schwer verständlich. Denn das Gehirn stellt Sekunden nach Unterbrechung
der Blutzufuhr seine elektrische Aktivität ein – oder etwa doch nicht?
Noch tappen die ForscherInnen im Dunkeln, doch Projektleiter Roland
Beisteiner ist überzeugt, dass es Erklärungen für derartige Erfahrungen
gibt: „Bis jetzt gibt es keine detaillierten Nachweise von Hirnaktivität
während der Reanimation, das heißt aber nicht, dass es nicht welche
gibt“, so der Neurologe der Medizinischen Universität Wien. Denn immer
mehr Daten, etwa von KomapatientInnen oder aus dem Bereich der
Anästhesie, würden zeigen, dass das Gehirn hohe Kapazitäten besitzt,
sich zu regenerieren und Informationen zu verarbeiten, ohne dass das von
außen wahrnehmbar ist.
DATEN VON GEHIRNSTRÖMEN SAMMELN
„Wir brauchen möglichst viele solcher physiologischen Daten und eine bessere
Kontrolle, was im Umfeld von Reanimationen passiert“, sagt Beisteiner.
Diese sollen nun gemeinsam mit dem Neurowissenschafter Michael Berger
und dem Notfallmediziner Fritz Sterz in der bereits laufenden
internationalen Studie AWARE, die von dem in New York tätigen
Notfallmediziner Sam Parnia koordiniert wird, erstmals erhoben werden.
Bereits im Vorfeld waren die österreichischen ForscherInnen an AWARE
(„AWAreness during REsuscitation“) beteiligt und haben Fragebögen von
PatientInnen ausgewertet, die wieder „ins Leben zurückgeholt“ wurden.
Als nächsten Schritt werden die Notfallstationen von medizinischen
Zentren in den USA, Großbritannien und Österreich mit Sensoren zur
Registrierung der Durchblutung und der elektrischen Aktivität des
Stirnhirns ausgestattet. Aus Tierversuchen wissen die ForscherInnen,
dass die Hirnaktivität bei Herzstillstand zwar rapide abfällt, aber
zunächst für rund 30 Sekunden weiter messbar ist. Eine kürzlich
durchgeführte amerikanische Studie legt sogar nahe, dass das Gehirn für
diese Zeit in eine Art Alarmzustand übergeht und Zeichen erhöhter
Bewusstseinsaktivität zeigt. Das könnte eine Erklärung für die von
einzelnen PatientInnen als „real“ empfundenen Erlebnisse während der
vermeintlichen Bewusstlosigkeit sein. Auch für die – noch seltener –
berichteten „außerkörperlichen Erfahrungen“ gibt es Erklärungen, denn
die visuell-räumliche Wahrnehmung kann manipuliert werden, wie etwa
Untersuchungen des in der Schweiz tätigen Neurologen Olaf Blanke
belegen. „Blankes Versuche zeigen, dass wir das Gefühl eine Einheit
darzustellen, manipulieren können“, sagt Beisteiner. „Das Gehirn scheint
die Veranlagung zu haben, dass diese Integration von Raum und Körper
gestört werden kann, sodass das Gefühl eines Heraustretens aus dem
Körper entsteht“, so der Neurologe.
WICHTIGE GRUNDLAGENFORSCHUNG
Das dreijährige FWF-Projekt „Gedächtnisprozesse bei Herzstillstand-PatientInnen“ (2015-2018) soll nicht nur wissenschaftliche Fakten zur Diskussion eines umstrittenen Themas
liefern, sondern künftig auch zur Verbesserung des technischen Ablaufes von Reanimationen beitragen. „Wir brauchen diese Forschung, um zu verstehen, was das Gehirn kann. Vor allem ist es für die Behandlung auch wichtig zu wissen, ob Patienten und Patientinnen etwas wahrnehmen, auch wenn es von außen nicht sichtbar ist“, betont Beisteiner.
Roland Beisteiner ist Facharzt für Neurologie und Psychiatrie an der Universitätsklinik für Neurologie der Medizinischen Universität Wien. Er erforscht die Funktionen des menschlichen Gehirns mit dem Fokus auf bildgebende Verfahren und ist Experte im Gebiet der klinischen funktionellen Magnetresonanztomographie (fMRT).
Link:
Erste Ergebnisse der AWARE-Studie wurden in dem Fachmagazin
„Resuscitation“
veröffentlicht: Sam Parnia et al: „AWARE – AWAreness during
REsuscitation – A prospective study“, Elsevier, Sept. 2014