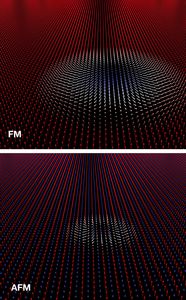Frankfurt a.M., 23. April 2013
Wissenschaftsforum Chemie 2013
Start am 1. September in Darmstadt
�Chemie
� Element unseres Lebens� ist das Motto des Wissenschaftsforums Chemie
2013, das vom 1. bis 4. September im Kongresszentrum Darmstadtium von
der Gesellschaft Deutscher Chemiker (GDCh) ausgerichtet wird. �Ein
solches Motto erzeugt unterschiedliche Reaktionen�, schreibt die
GDCh-Präsidentin, Professor Dr. Barbara Albert, in ihrer Einladung.
�Eigentlich ist es ja eine Selbstverständlichkeit, dass Chemie zu
unserem Leben gehört. Sie ist natürlich ein essentieller Baustein.
Chemikerinnen und Chemiker sind sich dessen bewusst, wie sehr alles um
uns herum Chemie ist: die grüne Farbe der Blätter genauso wie der
Elektrolyt in einer Batterie. Das macht es jedoch nicht überflüssig,
dass wir uns und Anderen diese Selbstverständlichkeit bewusst machen.
Dazu bietet sich unser alle zwei Jahre stattfindendes Wissenschaftsforum
an.�
Barbara
Albert, GDCh-Präsidentin und zugleich Geschäftsführende Direktorin am
Eduard-Zintl-Institut für Anorganische und Physikalische Chemie der
Technischen Universität Darmstadt, eröffnet am Sonntag, dem 1.
September, 17 Uhr, die viertägige Veranstaltung, die von den
Herausforderungen an unsere zukünftige Arbeitswelt über Themen wie
Chemie und Energie, Materialien, Umweltchemie sowie Katalyse bis hin zur
Jahrestagung der GDCh-Fachgruppe Chemieunterricht eine weites Spektrum
abdeckt. Das Grußwort der Bundesregierung wird die Bundesministerin für
Bildung und Forschung, Professor Dr. Johanna Wanka, überbringen. Weitere
Grußworte aus Politik und Wissenschaft folgen, darunter das des
Präsidenten der EuCheMS, des europäischen Dachver
bands der chemiewissenschaftlichen Gesellschaften, Professor Dr. Ulrich
Schubert, Wien, und der Präsidentin der britischen Royal Society of
Chemistry, Professor Dr. Lesley Yellowlees.
Zwei
bedeutende Preise, die Adolf-von-Baeyer-Denkmünze und der
Karl-Ziegler-Preis, werden im Rahmen der Eröffnungsveranstaltung
vergeben. Professor Dr. Klaus Müllen, Max-Planck-Institut für
Polymerforschung, wird mit der Adolf-von-Baeyer-Denkmünze der GDCh
ausgezeichnet, und zwar in Würdigung seiner herausragenden
wissenschaftlichen Beiträge zur Organischen Chemie ebenso wie zur
Polymerchemie und den Materialwissenschaften. Seine wegweisenden
Arbeiten � besonders sei hier die Erschließung der Nanographene
hervorgehoben � sind von internationalem Rang
und genießen höchste Beachtung. Organische Elektronikmaterialien,
insbesondere das Graphen, üben eine enorme Faszination auf
Naturwissenschaftler aus, und die chemische Industrie möchte sich damit
zukünftige Märkte sichern. Zu Beginn dieses Jahrhunderts mussten die
Synthesemethoden für die Herstellung von Nanographenen, den
zweidimensionalen À-konjugierten Oligomeren, erst entwickelt werden.
Dies gelang Müllen; allein dafür hätte er schon die Auszeichnung mit der
Adolf-von-Baeyer-Denkmünze verdient.
Besonders
hervorzuheben sind darüber hinaus das Anfang der 1990er Jahre von ihm
entwickelte Konzept der Leiterpolymeren, die organische Leuchtdioden
verbessern halfen. In der Folge gelang es Müllen auch, eine Vielzahl
wertvoller Fluor
eszenzfarbstoffe zu synthetisieren. Auf Basis von Hexabenzocoronen
gelangte Müllen zu flüssigkristallinen Materialien, die sich als gute
eindimensionale Halbleiter und Photoleiter erwiesen und die Nanographene
zur Realität werden ließen. Graphenfilme und deren Anwendung in
Solarzellen sind ein weiteres Beispiel für einen erfolgreichen
Brückenschlag zwischen Grundlagenforschung und anwendungsorientierter
Forschung. Müllens Ehrendoktorwürden, Ehrenprofessorentitel und hohe
Auszeichnungen aus dem In- und Ausland belegen sein wissenschaftliches
Renommee ebenso wie die Tatsache, dass er Deutschlands meistzitierter
Chemiker ist. Müllen war Präsident und Vizepräsident der GDCh, 2012
wurde er zum Präsidenten der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und
Ärzte gewählt.
Wer
den mit 50.000 Euro und einer Goldmünze dotierten Karl-Ziegler-Preis
der bei der GDCh ansässigen Karl-Ziegler-Stiftung erhalten wird, bleibt
weiter spannend. Die Entscheidung wird im Mai erwartet.
Die
Philharmonie Merck intoniert Stücke von Johann Strauß und Giuseppe
Verdi, bevor in der zweiten Hälfte der Eröffnungsveranstaltung zum
Wissenschaftsforum eine weitere bedeutende Auszeichnung der GDCh
vergeben wird: die August-Wilhelm-von-Hofmann-Vorlesung. Sie
wird in Darmstadt von Professor Dr. Linda Nazar vom Department of
Chemistry and Department of Electrical Engineering an der University of
Waterloo, Kanada, gehalten. In ihrem Vortrag stellt sie
dar, wie mit Hilfe der Nanotechnologie Probleme bei der Speicherung
hoher Energiedichten überwunden werden können. Die heutigen wieder
aufladbaren Lithium-Ionen-Batterien arbeiten nach dem Prinzip der
reversiblen Intercalation von Elektronen und Lithium-Ionen in
Materialien, deren Gitterstrukturen sich während der Redox-Zyklen nur
wenig verändern. Die Energiedichte dieser Materialien ist begrenzt.
Lithium-Schwefel- und Lithium-Sauerstoff-Batterien könnten die
Bedingungen für die Speicherung hoher Energiedichten erfüllen. Dafür
benötigen sie neuartige, leitfähige Nanomaterialien, die besondere
Anforderungen hinsichtlich ihrer Stabilität und elektrochemischen
Reversibilität erfüllen. Die Herausforderungen gegenüber dem Stand der
Technik werden anhand elektrochemischer und materialwissenschaftlicher
Kriterien erläutert. Und es wird dargestellt, welche ökonomischen
Hürden noch zu überwinden sind.
Die
Gesellschaft Deutscher Chemiker (GDCh) gehört mit über 30.000
Mitgliedern zu den größten chemiewissenschaftlichen Gesellschaften
weltweit. Alle zwei Jahre veranstaltet sie an wechselnden Orten in
Deutschland das Wissenschaftsforum. Zu diesem bedeutendsten deutschen
Chemiekongress werden von der GDCh auch internationale Wissenschaftler
von Rang und Namen zu Vorträgen eingeladen. Ferner werden zahlreiche
international beachtete Preise verliehen. Die erste Auszeichnung, die
anlässlich des Wissenschaftsforums 2011 vergeben wird, ist die Adolf-von
Baeyer-Denkmünze der GDCh, eine Goldmedaille, verbunden mit einem
Preisgeld von 7.500 Euro. Eine Namensvorlesung ist eine besondere
Auszeichnung der GDCh für erfolgreiche ausländische Wissenschaftler. Die
traditionsreichste und bedeutendste ist
die August-Wilhelm-von-Hofmann-Vorlesung.
Kontakt:
Dr. Renate Hoer