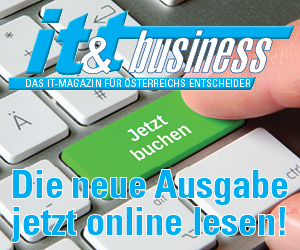Kinder müssen lernen, Algorithmen zu
lieben
(SZ) Deutschlands Schulen brauchen ein
Konzept für digitale Bildung. Wir sollten Algorithmen auf die Kinder loslassen
– und erklären, was hinter MP3, Google und GPS steckt.
Gastbeitrag von Ulrich Trottenberg
Von dem, was man heute "digitale
Revolution" nennt, macht sich die Öffentlichkeit nur ein diffuses Bild. Es
fehlt an Aufklärung. Deutschland braucht daher dringend ein Konzept für
digitale Bildung. Aber wie wollte das aussehen?
Bei Rechnern, Netzen und Datenmengen
steigt die Leistung exponentiell, es gibt fantastische Ingenieurleistungen. Zur
digitalen Aufklärung sollte gehören, dass der kompetente Nutzer lernt, die
Größenordnungen (TeraFlops für die Rechengeschwindigkeit, Gigabits pro Sekunde
für die Übertragungsgeschwindigkeit der Netze und Zettabyte für das globale
Datenaufkommen) einzuschätzen und die praktische Bedeutung exponentiellen
Wachstums zu verstehen. Mit den Algorithmen sieht das anders aus, sie lassen
sich nicht einfach quantitativ charakterisieren. Algorithmen sagen den
Rechnern, was sie tun sollen, sie regeln dynamisch, was wann wohin durch die
Netze an Daten fließt, sie strukturieren die Speicher und sie analysieren die
Daten. Ohne Algorithmen passiert gar nichts, sie sind das steuernde Element,
sozusagen "das Gehirn" aller IT-Komponenten.
Den Algorithmen wird deshalb Macht
angedichtet. Schon das Wort klingt geheimnisvoll. Algorithmen werden für
unerwünschte Entwicklungen verantwortlich gemacht: Sie spionieren uns aus,
kontrollieren uns , treffen lebenswichtige Entscheidungen, sie bringen die
Finanzmärkte durcheinander, gefährden den Frieden- so heißt es. Tatsächlich
sind Algorithmen Mathematik oder Informatik. Sie sind also logisch und nicht
prinzipiell unverständlich, es sind Handlungsanweisungen, der Kern der
Programme, die der Rechner versteht. Und sie sind – wie die Mathematik
insgesamt – wertneutral. Messer sind ja auch im Alltag unverzichtbar und können
doch Mordinstrumente werden. Ihr mathematischer Charakter macht Algorithmen für
die meisten Menschen nicht sympathischer. Journalisten, die in Talkshows mit
ihren mangelhaften Leistungen im Mathematikunterricht kokettieren, sind sich
gleichwohl nicht zu schade, die Öffentlichkeit über die Gefahren der
Algorithmen zu "informieren".
Sollen alle Kinder Programmieren lernen?
Forscher, Lehrer und Kinder geben eine eindeutige Antwort. 360° Digitalisierung
der Kindheit
Digitale Bildung kommt an Algorithmen
nicht vorbei. Die digitale Aufklärung der Öffentlichkeit und die digitale
Bildung der jungen Generation bleiben begrenzt und oberflächlich, wenn es nicht
gelingt, wenigstens die Idee des Algorithmischen und eine elementare Kenntnis
algorithmischer Prinzipien zu vermitteln. Der Autor und seine Partner haben
gute Erfahrungen damit gemacht, Algorithmen in den Schulunterricht einzubetten.
Sie haben rund 25 elementare und nicht elementare, klassische und hochaktuelle
Algorithmen zum Gegenstand der Lehrerbildung gemacht und in der Schulpraxis
erprobt. Die gesamte Bildungskette wird dabei abgedeckt, von der schriftlichen
Multiplikation in der Grundschule, über den Euklidischen Algorithmus bis hin
zur Verschlüsselung und zum Data Mining.
Kein Schüler fragt mehr: Wozu machen wir
das überhaupt?
Im Vordergrund steht immer die tägliche
Erfahrung: MP3, GPS, Scheckkarten-Verschlüsselung, Google Page Ranking sind
Algorithmen, die Schüler begeistern. Kein Schüler stellt mehr die Frage: Wozu
machen wir das überhaupt? Werde ich das im Leben jemals brauchen? Sie verstehen
oder erahnen, was auf ihren Handys unsichtbar abläuft, und sie erkennen zudem,
wozu Analysis, lineare Algebra, Stochastik gebraucht werden. Auch wenn
Algorithmen noch nicht in den Kernlehrplänen stehen, im Mathematik-,
Informatik- oder im Fachunterricht, in Sonderveranstaltungen und Projektwochen
können Schüler Algorithmen verstehen und selbst entdecken. Sie können sich
vorstellen, wie etwa Google mit unseren Daten umgeht, warum Daten so wertvoll
sind – und werden hoffentlich vorsichtiger und verantwortungsvoller im Umgang
mit ihren eigenen Daten. Auch schwächere Schüler gewinnen der Thematik
Erstaunliches ab, weil sich manche der Algorithmen auch ohne Vorkenntnisse
behandeln lassen. Und schließlich gewinnen die Lehrer durch ihr fundierteres
Wissen ihre pädagogische Souveränität wieder.
Digitale Kindheit anno dazumal Mit diesen
Geräten trieben Kinder ihre Eltern früher in den Wahnsinn
Vom Algorithmus zum Computerprogramm ist
es nur ein kleiner Schritt. Große Softwaresysteme setzen sich aus einer
Vielzahl oft einfacher, aber intelligent kombinierter Algorithmen zusammen. Es
wird immer einige Schüler geben, die sich für die Programmierung begeistern,
neue algorithmische Konzepte selbst entwickeln und vielleicht schon eine
Geschäftsidee haben oder bei sich Forschungsinteressen entdecken.
Ulrich
Trottenberg, 71, ist ehemaliger Leiter des Fraunhofer-Instituts für Algorithmen
und Wissenschaftliches Rechnen.