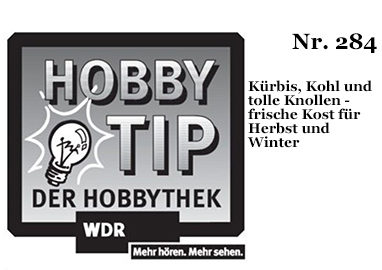Liebe TELI-Mitglieder, Liebe Nina Eichinger, lieber Arno Kral, lieber Hajo Neubert, lieber Wolfgang Goede,
vielen Dank für den Bericht, dem ich voll
zustimme. Er erinnert mit daran, dass ich mittlerweile fast 49 Jahre
Mitglied bei der TELI bin, mir aber gleichzeitig ein schlechtes Gewissen
verursacht, dass ich mich so wenig in Ihre lobenswerten Aktivitäten
eingebracht habe, obwohl wir alle an einem Strang ziehen.
Wie Sie wissen, war ich einer der Gründerväter
und langjähriger 1. Vorsitzender der Wissenschaftspressekonferenz, die
wir seinerzeit wegen der wissenschaftlichen Glaubwürdigkeit gegründet
haben, um garantiert Einflüsse von industrieller und politischer Seite
zu minimieren. Dieser Arbeit habe ich mich ganz besonders gewidmet,
trotzdem aber die Aktivitäten der TELI stets mit Wohlvollen verfolgt,
auch die Turbulenzen, in die sie geraten ist, bin ich ihr als Mitglied
bewusst treu geblieben. In einer postfaktischen Zeit ist es umso
wichtiger, dass wir am gleichen Strang ziehen. Wenn Wissenschaft bei
politischen Entscheidungen keine Relevanz bekommt, geht unsere
Demokratie baden.
Alle in Ihrem Schreiben genannten Aktivitäten
unterstütze ich deswegen auf das Intensivste. Wie Sie wissen, habe ich
meine Arbeit als Wissenschaftsjournalist vor allen Dingen auch der
Tatsache gewidmet, dass auch Menschen, die der Notwendigkeit der Logik
und der Vernunft nicht so große Bedeutung beimessen, wenigstens so
informiert werden, dass ihnen die Errungenschaften der Wissenschaft und
Technik und ihr Nutzen – wenn auch nur emotional – plausibel bleiben.
Die ‚Hobbythek‘ war für mich ein trojanisches Steckenpferd, um das zu
vermitteln.
Nach meiner Pensionierung führe ich diese
Aktionen weiter. Ich unterhalte z. B. eine offizielle Seite bei
Facebook, weil ich glaube, damit immer noch jüngere Menschen erreichen
zu können. Unter dem Obertitel ‚Der Vernunft eine Chance‘ weise ich dort
eklatante Widersprüche in der Technologie-Politik auf. Mit über 40.000
Abonnenten und einer Reichweite von 200.000 Bürgern scheine ich
zumindest eine gewisse Aufmerksamkeit zu erreichen, wenngleich das auch
nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist.
Schon vor 15 Jahren scheine ich vorausgesehen
zu haben, dass bewusste Falschmeldungen – auch aus der Wissenschaft –
unsere Bürger auf die Dauer vom Verständnis und der Einordnung unserer
technischen Errungenschaften immer weiter entfernen, so dass Scharlatane
die Möglichkeit haben, den Bürgern die Sterne vom Himmel zu holen, ganz
nach dem Motto: Wir brauchen keine Kraftwerke, bei uns kommt der Strom
aus der Steckdose.
Deshalb habe ich damals schon eine Homepage: www.jean-puetz.net eröffnet, auf der sich mittlerweile unter dem Button ‚Lexikon der
Wissenschaft‘ über 50.000 garantiert seriöse, wahrhafte und
verständliche Meldungen angehäuft haben. Dass diese intensiv besucht
wird, zeigt sich besonders, seit dem wir die Rubrik ‚Wissenschaft –
soeben eingetroffen‘ geschaffen haben. Successive gehen diese Berichte
dann ins ‚Lexikon der Wissenschaft‘ über.
Wir sollten versuchen, die hervorragenden
Tätigkeit der TELI mit meiner zu verlinken. Im Voraus werde ich den
Beitrag ‚TELI-Jahresendansprache: Mit Tradition und Innovation die
Zukunft der TELI gestalten‘ veröffentlichen. Dort befinden sich auch
unter dem Button ‚Gedanken zur Zeit‘ etliche, mehr philosophische
Berichte, die auch ganz gut auf die Homepage der TELI passten. Ich habe
nichts dagegen, wenn bestimmte Meldungen daraus von der TELI
aufgegriffen würden.
Ich wünsche einen fröhlichen Rutsch und für das Jahr 2019 Frieden, Gesundheit, Glück und viel Erfolg.
Ihr Jean Pütz
Liebe Damen und Herren in der TELI, liebe Freundinnen und Freunde in der TELI,
Im
Jahr 2019 jährt sich die Mondlandung zum 50. Mal. Dieses Ereignis hatte
nicht nur mich als damals 13-Jährigen, sondern auch viele andere an
Fortschritt durch Technik und Wissenschaft glauben lassen. Dieser Tage
stehen Menschen unter dem Eindruck der alle Lebensbereiche
durchdringenden Datenkraken und damit dem technischen und
wissenschaftlichen Fortschritt oftmals skeptisch gegenüber. Dabei
überwiegt im Wesentlichen das Gute daran! In keinem Zeitalter gab es im
Verhältnis zur Gesamtbevölkerung weniger Kriegs-, Hunger- oder
Seuchentote auf der Welt. Denjenigen, die sich in der TELI organisiert
hatten, war es zur Aufgabe geworden, durch Recherche und Publikationen
den Fortschrittsglauben zu befördern, Technik zu erklären, die
Errungenschaften der Forschung in einen gesellschaftlichen Kontext zu
stellen und Visionen für eine Entwicklung ein eine bessere Zukunft zu
vermitteln. Bringen Sie sich ein! Lassen Sie uns miteinander eine
Mission, einen Schwerpunkt für die Arbeit der TELI in den kommenden zehn
Jahren entwickeln.
Die
TELI ist in ihren Veranstaltungen durchaus modern! Immer wieder nehmen
Print- und Medien wie der SPIEGEL, die Süddeutsche Zeitung oder das
Wissenschaftsmagazin „nano“ Themen auf, welche die TELI mithin viele
Monate zuvor zu Inhalten ihrer Jour-fixe oder Exkursionen auserkoren
hatte: Epigenetik, Erneuerbare Energien und deren Verteilnetze,
Elektromobilität und deren Infrastrukturbedarf, thermische
Abfallverwertung, Robotik, Künstliche Intelligenz, die Gefahren für
Augen durch LED- und Bildschirmbeleuchtung, Bedrohungen aus dem
Internet, dem Darknet – um nur einige zu nennen. Zu nennen wäre in
diesem Zusammenhang auch „Wissenschaft im Dialog – die Initiative der
deutschen Wissenschaft“ https://www.wissenschaft-im-dialog.de/projekte/wissenschaft-kontrovers/,
die sich an ein Format anhängt, das die TELI entwickelt und mehrfach
erfolgreich umgesetzt hat – die „Wissenschaftsdebatte“. Um mit diesem
Potenzial erfolgreich sein zu können, braucht die TELI ein neues
Narrativ. Wie im Betreff zu lesen, möchte ich das Narrativ „Mit
Tradition und Innovation in die Zukunft der TELI“ vorschlagen. Helfen
Sie mit dabei!
Denn:
Im Jahr 2019 wird die TELI 90 Jahre alt, ein Grund zum Feiern für alle,
die in der TELI organisiert sind, aber auch ein Grund, darüber
nachzudenken, wie es gelingen kann, unsere ehrwürdige
Journalistenvereinigung bis zu einem 100-jährigen Jubiläum weiter zu
führen, wieder mehr mit Leben zu füllen und deutlich zu verjüngen, und
was jeder und jede einzelne dafür tun kann. Doch ohne die aktive
Mithilfe möglichst aller Mitglieder der TELI wird es kaum gelingen, die
TELI zu verjüngen. Also: Werben Sie in Ihrem Umfeld und schreiben Sie
auch für die TELI-Web-Seite! Bedenken Sie, dass die 2016 in Kraft
getretenen Änderungen an TELI-Satzung und TELI-Geschäftsordnung nun auch
Menschen die Mitgliedschaft erlaubt, die keine reinen
Medien-Journalistinnen und –Journalisten sind. Ein Weiter-so wird
aufgrund der demographischen Faktenlage die nächste Dekade nicht
durchzuhalten sein.
Nutzen
Sie die neue, professionell designte und gewartete TELI-Web-Seite. Sie
war auch deshalb eingerichtet worden, um auch denjenigen
TELI-Mitgliedern, die nicht mehr im Berufsleben stehen, eine einfach zu
bedienende Plattform zur Veröffentlichung all jener Geschichten zu
bieten, für die sich kein Verleger findet, die aber dennoch gelesen
werden sollten. Ich unterstelle, dass viele von uns noch viel zu sagen
haben. Doch obwohl die neue TELI-Web-Seite nun bereits seit drei Jahren
in Betrieb ist, lässt sich die Zahl derjenigen, die einen Autorenzugang
beantragt haben, an einer Hand abzählen. Umso mehr möchte ich mich bei
denjenigen bedanken, die mit ihren Berichten und Geschichten ihren
Beitrag dazu geleistet haben, der TELI über ihr zentrales Organ eine
Öffentlichkeit zu verschaffen. All jene, die sich nicht mehr mit unserer
Publikations-Maschine befassen wollen oder können, können mit Hilfe
unserer Web-Masterin Nina Eichinger und unseres Content-Managers Hajo
Neubert ihre Geschichten dennoch veröffentlichen, wenn sie diese nur –
gerne auch mit begleitendem Bildmaterial – per E-Mail an den vorstand@teli.de schicken.
Die
Mitglieder der TELI fordere ich ferner auf, unsere Web-Seite häufiger zu
besuchen. Denn hier finden sie alle für den Verein und seine Mitglieder
relevanten Informationen – auch solche, ehedem zumeist über die
ehemalige Yahoo-Mailing-Liste verteilt worden sind, darunter
Veranstaltungshinweise, Ausschreibungen, Reportagen und Berichte. Aus
Gründen der neuen Europäischen Datenschutzgrundverordnung (EU-DSVGO) war
ein Weiterbetrieb der Yahoo-Liste rechtlich viel zu unsicher. Dennoch
mehren sich Stimmen, einen Ersatz für die Yahoo-Liste zu finden, und
auch Menschen außerhalb der TELI wieder mit Informationen aus der TELI
und von TELI-Mitgliedern zu versorgen. Der Vorstand arbeitet bereits an
einer rechtskonformen Lösung, muss aber auf die erhebliche
Arbeitsbelastung hinweisen, die mit Einrichtung, Wartung und Pflege
einer neuen, DSVGO-konformen Mailing-Lösung einhergeht.
Im
Jahr 2019 steht uns die nächste TELI-Mitgliederversammlung ins Haus. Aus
Kostengründen und aufgrund der Mitgliederdichte soll sie sie erneut im
Münchner Raum stattfinden, idealerweise noch im Frühjahr. Turnusmäßig
steht die Wahl sämtlicher Mitglieder des TELI-Vorstands und der
TELI-Gremien auf der Tagesordnung. Ich bitte alle TELI-Mitglieder, sich
aktiv ins Vereinsleben einzubringen und sich für diese ehrenamtlichen
Posten zu bewerben.
Ich hoffe auf Ihre aktive Beteiligung an der Gestaltung der TELI-Zukunft – schreiben Sie mir.
Ich
wünsche mir Ihre rege Beteiligung an unseren TELI-Jour-fixen zu
technisch- wissenschaftlichen Themen mit gesellschaftlicher Relevanz und
fordere Sie auf, solche Veranstaltungen zu organisieren – der Vorstand
hilft gerne dabei.
Und
ich zähle auf Ihre Anwesenheit bei der nächsten Mitgliederversammlung –
es geht um nichts Geringeres als das Fortbestehen unseres Vereins, ganz
im Sinne des Narrativs: Mit Tradition und Innovation die Zukunft der
TELI gestalten.
Ich
wünsche Ihnen und euch von Herzen geruhsame und besinnliche Feiertage
und für das Neue Jahr 2019 Gesundheit, Glück und allzeit gute Laune.
Lassen Sie mich meine Weihnachtsbotschaft schließen mit dem Verweis auf
Wolfgang Goedes Beitrag für die TELI-Web-Seite, die
„TELI-Sternstunden-Bücher“, siehe https://www.teli.de/teli-sternstunden-buecher-zu-weihnachten-2018/.
Er beweist mit seinen Artikeln immer wieder aufs Neue, dass ein Leben
im Ruhestand nicht der Abschied vom aktiven Journalismus sein muss.
Arno Kral
Vorsitzender TELI e.V.