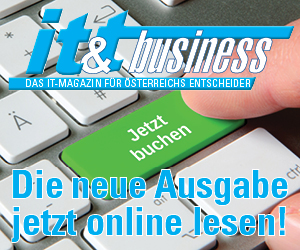Kraftstoffe
mithilfe von erneuerbaren Energiequellen preiswert und klimafreundlich
herstellen – das ist die Mission des Start-ups INERATEC, einer
Ausgründung aus dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT).
Eigentlich sind bei der Produktion von synthetischen Kraftstoffen wie
Benzin riesige Anlagen nötig. INERATEC baut chemische Reaktoren, die so
kompakt sind, dass die fertig montierte Anlage in einen Schiffscontainer
passt und überall eingesetzt werden kann. Für diese Idee hat das junge
Unternehmen nun den erstmals vergebenen Lothar-Späth-Award erhalten.
„Synthetische
Kraftstoffe sind ein wesentlicher Baustein für den effektiven
Klimaschutz. Die von INERATEC entwickelten Technologien unterstützen
maßgeblich dabei, diese Kraftstoffe breit verfügbar zu machen“, sagt der
Präsident des KIT, Professor Holger Hanselka. „Ich freue mich
besonders, dass eine Ausgründung des KIT den ersten Lothar-Späth-Award
erhält. Die Auszeichnung zeigt erneut, wie innovativ unsere
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler arbeiten.“
Das Prinzip hinter
synthetischen Kraftstoffen ist das Herstellen von Benzin, Kerosin,
Diesel oder Methan aus Treibhausgasen wie zum Beispiel bisher
ungenutztem CO2 – etwa aus Biogasanlagen oder direkt aus der
Atmosphäre – und regenerativ erzeugtem Wasserstoff. Bislang war dies
umständlich und teuer, weil hierfür großtechnische Chemieanlagen nötig
waren. Die Karlsruher Gründer von INERATEC haben diese Anlage auf
Miniaturformat geschrumpft, sodass sie in einem Schiffscontainer Platz
findet. „Was wir anbieten, sind fertig montierte Kompaktanlagen, die
nach dem Baukastensystem konzipiert sind, sodass sich die Kapazität ganz
nach Bedarf erweitern lässt“, erläutert Tim Böltken,
INERATEC-Geschäftsführer und Alumnus des KIT. Wird auch die für den
Herstellungsprozess benötigte Energie aus regenerativen Quellen wie
Sonnen-, Wind- oder Wasserkraft hergestellt, entsteht ein
klimafreundliches Produkt. „Mit unseren Anlagen kann also erneuerbare
Energie in chemischen Energieträgern gespeichert werden“, so Böltken.
Mehrere Anlagen sind
bereits ausgeliefert und in Betrieb: Eine Power-to-Liquid-Anlage, welche
erneuerbare flüssige Kraftstoffe herstellt und mobil eingesetzt werden
kann, wurde nach Finnland verkauft. Im katalonischen Sabadell steht eine
Power-to-Gas-Anlage, die aus Kohlenstoffdioxid, das aus Klärschlamm
stammt, synthetisches Methangas produziert, das direkt ins spanische
Netz gespeist werden soll. Am KIT selbst – wo mit dem Energy Lab 2.0
gerade ein Anlagenverbund aufgebaut wird, der unterschiedliche
Technologien zur Erzeugung und Nutzung elektrischer, thermischer und
chemischer Energie verknüpft – baut INERATEC eine Pilotanlage für die
Erzeugung von erneuerbarem Kerosin aus Kohlendstoffdioxid und
Wasserstoff.
Für INERATEC rundet der
Lothar-Späth-Award ein sehr erfolgreiches Jahr ab: So erhielt das Team
im September den Deutschen Gründerpreis und im November den Sonderpreis
für innovative Start-ups beim Innovationspreis der Deutschen
Gaswirtschaft. Zudem zählt das Team in der Kategorie Unternehmer zur
„Jungen Elite – die Top 40 unter 40“ der Zeitschrift Capital.
Weitere Preise für innovative Beschichtungen und Spezial-Laser
Mit dem zweiten Preis
würdigte die Jury die Nanopta GmbH für die Entwicklung von
Antireflexionsbeschichtungen, die – nach dem Vorbild der Augen von
Nachtfaltern – dank besonderer Nanostrukturen optische Bauteile und
Linsen entspiegeln. Der dritte Preis ging an die Active Fiber Systems
GmbH im thüringischen Jena für ein neuartiges Ultrakurzpulslaser-Gerät
zum Einsatz in der Materialbearbeitung, in der Grundlagenforschung zur
Licht-Materie-Wechselwirkung und zur Krebstherapie.
Der Lothar-Späth-Award
Der Lothar-Späth-Award
wurde im Jahr 2018 erstmals zu Ehren von Professor Dr. h. c. Lothar
Späth verliehen. Er fördert herausragende innovative Kooperationen aus
Wirtschaft und Wissenschaft in Baden-Württemberg und Thüringen. Der
Preis ist insgesamt mit 40 000 Euro dotiert, der Hauptpreis beträgt 25
000 Euro. Er zielt auf die Entwicklung besonders wegweisender Produkt-,
Verfahrens- und Dienstleistungs-Innovationen ab. Eine breite Initiative
von Unternehmen, Personen und Institutionen hat sich als Förderer und
Jury des Awards zu Ehren von Lothar Späth zusammengeschlossen. Dr.-Ing.
E. h. Martin Herrenknecht, der Gründer und Vorstandsvorsitzende der
Herrenknecht AG ist Hauptinitiator des Awards und Jurymitglied.
Vorsitzender der Jury ist der Präsident des Karlsruher Instituts für
Technologie (KIT), Professor Dr.-Ing. Holger Hanselka. Ebenfalls in der
Jury sind EU-Kommissar Günther H. Oettinger, Altkanzler Dr. h. c.
Gerhard Schröder, Rainer Neske, Vorstandsvorsitzender der LBBW,
Hans-Jörg Vetter, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Herrenknecht AG,
Dr. Stefan Traeger, Vorstandsvorsitzender der Jenoptik AG, Dr. Daniela
Späth-Zöllner, Tochter von Lothar Späth als Vertreterin der Familie,
sowie die Bizerba SE & Co. KG.