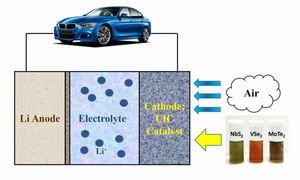ISH: Verbesserte Elcore-Brennstoffzelle erweitert BHKW-Einsatzmöglichkeiten
München,
2. Februar 2017 – Der Münchner Hersteller Elcore zeigt auf der ISH 2017
eine neue Version des Brennstoffzellen-BHKWs Elcore 2400 mit deutlich
erweitertem Einsatzbereich. Die maximale Vorlauftemperatur steigt von
60°C auf 70°C, die zulässige Rücklauftemperatur auf 50°C. Das erweitert
den Einsatzbereich von Elcore-Brennstoffzellenheizungen auf bestehende
Gebäude mit herkömmlichen Heizkörpern und höheren Systemtemperaturen.
Zusätzlich steigert das Geräte-Update die Effizienz des gesamten
Energiesystems und erhöht den Trinkwasserkomfort.
Pressebilder: http://www.elcore.com/unternehmen/presse/
Heizkörper dominieren im Bestand
Bestehende
Gebäude sind laut einer Untersuchung des Bundesverbandes der Deutschen
Heizungsindustrie BDH zu rund 90 Prozent mit Heizkörpern ausgestattet.
Diese benötigen in der Regel höhere Vorlauftemperaturen als moderne
Flächenheizungen, vor allem wenn sie als Einrohrsystem ausgeführt sind.
Die neuen Versionen der Elcore Komplettsysteme eignen sich auch für
solche Anlagen ebenso wie für Heizungen mit einer ungünstigen
Temperaturspreizung zwischen Heizungsvorlauf – und rücklauf.
Dr. Manfred
Stefener, Elcore Geschäftsführer: „Unsere Fachpartner können Elcore
Energiesysteme nun universell und nahezu wie konventionelle
Brennwert-Heizgeräte einsetzen. Sie müssen weniger Rücksicht auf die
vorhandene Heizungstechnik nehmen als bisher.“
Höhere Effizienz und mehr Trinkwasserkomfort
Die höhere
Vorlauftemperatur der neuen Version der Elcore 2400 erweitert nicht nur
die Einsatzmöglichkeiten des Nano-BHKWs. Sie wirkt sich zusätzlich
positiv auf die Effizienz des gesamten Energiesystems aus, da die
Schichtung im oberen Bereich des Warmwasserspeichers verbessert wird.
Dadurch erhöht sich zusätzlich der Trinkwasserkomfort und die
Schüttleistung steigt.
Elcore Lieferprogramm rund um das Nano-BHKW Elcore 2400
Das
Brennstoffzellen-BHKW Elcore 2400 wird als Teil der Elcore
Heizungs-Komplettpakete angeboten. Es hat eine thermische Leistung von
700 Watt sowie eine elektrische Leistung von 305 Watt, die auf den
Grundbedarf eines herkömmlichen Einfamilienhauses abgestimmt sind.
Das Paket
Elcore 2400 Max enthält neben dem BHKW die notwendigen Komponenten für
den Heizungstausch und -neubau wie eine Gas-Brennwerttherme sowie einen
Elcore Energiespeicher mit hygienischer Warmwasserbereitung. Das Paket
Elcore 2400 Plus, bestehend aus der Elcore 2400 und einem Elcore
Energiespeicher, eignet sich hervorragend, um eine Heizungsanlage mit
einer bestehenden, modernen Therme zu optimieren, ohne die Therme
austauschen zu müssen. Beide Pakete sind mit unterschiedlichen
Speichergrößen von 560 Liter bis 1.640 Liter verfügbar. Passende
Abgassysteme und Zubehör zur fachgerechten Montage sind ebenfalls Teil
des Elcore Lieferprogramms.
Elcore auf der ISH: Halle 9.0, Stand E36
Für Presserückfragen steht Ihnen German Lewizki (Sunbeam Communications) zur Verfügung. Email: lewizki@sunbeam-communications.com, Tel. +49 30 726296450
Über Elcore
Die Elcore
GmbH ist ein konzernunabhängiges Technologieunternehmen mit Hauptsitz in
München. Elcore entwickelt und produziert Produkte und Lösungen zur
hocheffizienten Wärme- und Stromversorgung von Gebäuden. Im Zentrum der
Produktpalette stehen Blockheizkraftwerke mit modernster
Brennstoffzellen-Technologie für den Heizungsneubau, den Heizungstausch
und die Modernisierung bestehender Heizungen in Ein- und
Zweifamilienhäusern (Nano-BHKW). Elcore verfügt über eine hohe
Entwicklungs- und Fertigungstiefe und produziert alle wichtigen
Baugruppen seiner Brennstoffzellen-BHKWs selbst.