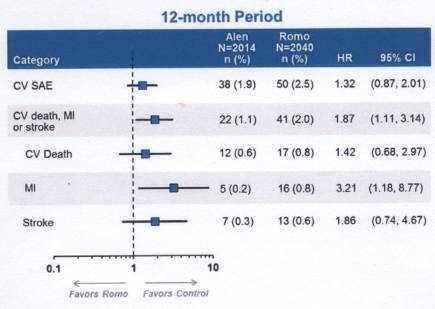Live-Schaltung in die Nervenzelle
Max-Planck-Forscher beobachten erstmals den Proteinabbau direkt in Gehirnzellen
Neurodegenerative
Krankheiten wie Alzheimer, Huntington oder Parkinson beruhen auf
fehlerhaften Proteinen, die miteinander verklumpen,
sich in Nervenzellen des Gehirns ablagern und diese lähmen oder gar zum
Zelltod führen. In gesunden Zellen verhindert das ein als Proteasom
bekannter Enzymkomplex, der alte oder fehlerhafte Proteine abbaut und
recycelt.
Forscher um Wolfgang Baumeister am
Max-Planck-Institut für Biochemie in Martinsried bei München konnten nun
erstmals das Proteasom in gesunden Gehirnzellen bei der Arbeit
beobachten
und strukturell charakterisieren. „Als wir die Proteasomen auf unserem
Bildschirm sahen, waren wir uns sofort der großen Bedeutung bewusst“,
erinnert sich Shoh Asano, Erstautor der Studie. Die Ergebnisse wurden
nun im Journal
Science veröffentlicht.
Wissenschaftler
schätzen, dass unser Gehirn aus etwa zehn bis einhundert Milliarden
Nervenzellen besteht. Damit sie möglichst lange ihre
Funktionen im Gehirn wahrnehmen können, müssen sie die Proteine in
ihrem Inneren stets auf Qualität und Funktionalität prüfen und
gegebenenfalls ersetzen. Andernfalls drohen diese zu verklumpen und so
die Zelle zu lähmen oder im schlimmsten Fall zu deren Absterben
zu führen. Erkennt die Zelle ein defektes Protein, markiert sie dieses
zum Abbau. Das so gekennzeichnete Protein wird von einer Art molekularen
Schreddern, sogenannten Proteasomen, erkannt und in seine recylebaren
Einzelteile zerlegt.
Was bisher
hauptsächlich im Reagenzglas untersucht wurde, konnten Forscher nun
erstmals direkt aus intakten Nervenzellen in einem dreidimensionalen
Computermodell abbilden. Möglich werden die Aufnahmen maßgeblich durch
die sogenannte Elektronenkryotomographie. Dabei wurden die Zellen
zunächst innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde schockgefroren, ihr
Inneres aus mehreren Winkeln aufgenommen und am Computer
dann dreidimensional abgebildet.
„Zum ersten Mal in intakten Zellen“
Durch gezielte
technische Neuerungen gelang den Forschern in der aktuellen Studie eine
bislang unerreichte Qualität in der Bildgebung, die es erlaubt,
einzelne Proteasomen innerhalb der Zellen zu unterscheiden. „Es ist zum
ersten Mal möglich, diesen wichtigen Enzymkomplex innerhalb einer
intakten Zelle qualitativ und quantitativ zu beschreiben“, ordnet Asano
die Ergebnisse ein.
In den folgenden
Experimenten konzentrierten sich die Wissenschaftler nun darauf, die
Aktivität der Proteasomen zu untersuchen. Dazu muss man wissen:
an den Enden eines Proteasoms finden sich spezielle kappenartige
Strukturen, die regulatorischen Partikel (s. Abbildung). Sie binden das
zum Abbau markierte Protein und ändern dabei Ihre Form. Die
Wissenschaftler konnten zwischen diesen verschiedenen Zuständen
der regulatorischen Partikel unterscheiden und so auswerten, welche der
Proteasomen sich momentan bei der Arbeit befanden.
Neue Möglichkeiten für die Zukunft
Das Fazit der
Forscher: befindet sich die Nervenzelle wie im aktuellen Experiment im
Ruhezustand, ist nur eine Minderheit der Proteasomen aktiv.
Konkret zeigten die Ergebnisse, dass nur jedes vierte Proteasom
Proteine schredderte, während die übrigen zum gleichen Zeitpunkt
ungenutzt blieben. Künftig wollen die Wissenschaftler insbesondere die
strukturellen Zustände der Proteasomen unter zellulärem
Stress untersuchen, wie er bei neurodegenerativen Krankheiten auftritt.
„Diese Studie zeigt die neuen Möglichkeiten, Proteinkomplexe in ihrer
Gesamtheit in der Zelle aufzulösen und ihre gegenseitigen funktionellen
Verzahnungen zu studieren“, gibt Wolfgang
Baumeister die Agenda für die Zukunft vor. [HS]