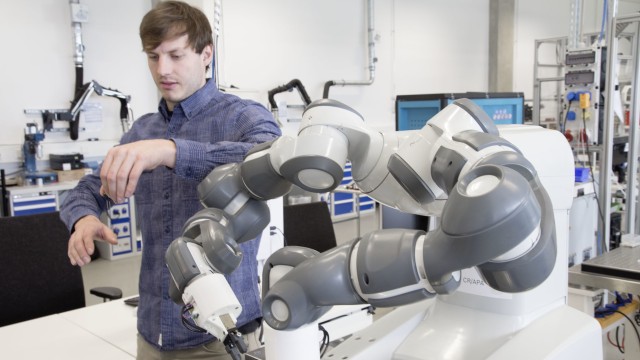Borkum als allergikerfreundliche Insel gekürt
Europäisches Allergie-Forschungszentrum zeichnet Urlaubsregionen aus
Signalstelle: Auf Borkum können Allergiker durchatmen (Foto: pixelio.de, Harms)
Berlin (pte001/13.04.2013/06:00) – Die ostfriesische Insel Borkum http://borkum.de hat von der Europäischen Stiftung für Allergieforschung (ECARF) http://ecarf.org das Zertifikat für Allergikerfreundlichkeit erhalten. "Wir haben durch unser Hochseeklima ja nicht nur eine besonders pollenarme Luft, sondern jetzt auch Unterkünfte und Einzelhändler, die sogar darauf achten, dass nicht mal Grünpflanzen in der Dekoration sind, die einem die Tränen in die Augen treiben", so Tourismusdirektor Stefan Krieger.
Mit der Zertifizierung ist Borkum die erste Insel, deren touristische Infrastruktur sich nach den medizinisch-wissenschaftlichen Kriterien der Stiftung ECARF auf die Bedürfnisse von Allergikern eingestellt hat. Die an die teilnehmenden Betriebe gestellten Anforderungen sind streng, so ECARF-Pressesprecher Matthias Colli gegenüber pressetext. Glatte Bodenbeläge, ausgezeichnete Inhaltsstoffe der angebotenen Lebensmittel, spezielle gefilterte Staubsauger sowie milbendichte Matratzenüberzüge sind nur einige der Kriterien.
Weitere Allergikerfreundliche Regionen
Neben der Insel Borkum sind auch das Schmallenberger Sauerland mit der Ferienregion Eslohe http://schmallenberger-sauerland.de sowie Baabe auf Rügen http://allergikerfreundliche-gemeinde.de , Bad Hindelang im Allgäu http://bad-hindelang-urlaub.de und der Verbund "Ferienland Schwarzwald" http://dasferienland.de in Deutschland mit diesem Zertifikat ausgezeichnet worden.
"Bad Hindelang ist ein Modellprojekt unserer Arbeit, denn in dieser Region beschäftigen sich die Anbieter vom Bäcker über den Metzger bis zu den Hotelbetrieben seit Jahren mit dem Thema Allergie", so Colli. In Hinblick auf die immer größere Zahl an Allergikern sei das ein sehr wichtiger Punkt, räumt der Experte ein. Daher habe man auch die Plattform ECARF-Travel http://ecarf-travel.org geschaffen, auf der zertifizierte Betriebe aus ganz Europa gelistet sind.
Urlaub soll auch Allergikern Erholung bringen
"Reisen kann für Allergiker mitunter beschwerlich sein, denn ganz egal ob Tierhaar-, Hausstaub- oder Nahrungsmittelallergie – die Betroffenen müssen auch im Urlaub sehr achtsam sein", so Colli. Das ECARF-Qualitätssiegel, welches die erfüllten Anforderungen des European Center for Allergy Research Foundation auszeichnet, kennzeichnet Produkte und Dienstleistungen, die Allergikern das Leben nachweislich erleichtern. Es ist das einzige europaweit gültige Zertifikat für allergikerfreundliche Produkte und Dienstleistungen.
"Wer als Asthmatiker nachts ruhig durchschlafen kann, wer als Nahrungsmittelallergiker am Frühstücksbuffet Wahlmöglichkeiten hat, wird den Urlaub mehr genießen und sich besser erholen", meint Torsten Zuberbier, Leiter der Europäischen Stiftung für Allergieforschung.