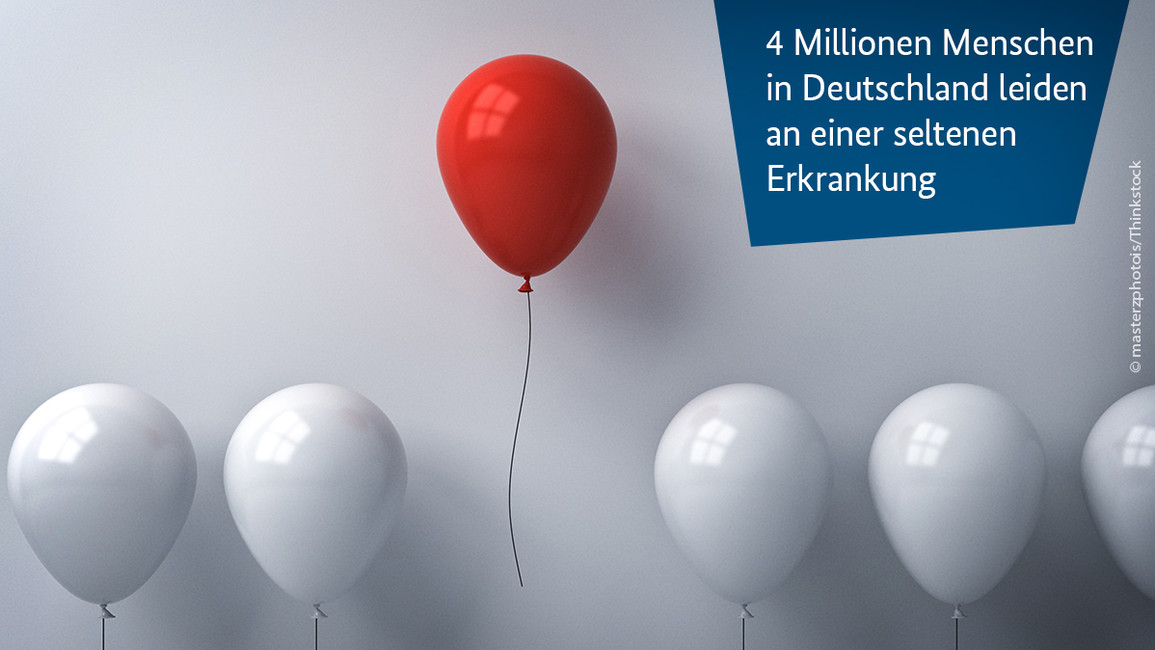Patienten mit erhöhtem Lipoprotein(a)-Spiegel frühzeitig identifizieren
Regenstauf – Erhöhte LDL-Cholesterinwerte im Blut steigern bekannter Maßen das Risiko, einen Herzinfarkt oder Schlaganfall zu erleiden. Weniger Beachtung findet allgemein ein nicht minder risikoträchtiger Verwandter des „bösen“ Cholesterins: das so genannte Lipoprotein(a). Menschen, die – erblich bedingt – einen erhöhten Lipoprotein(a)-Spiegel haben, können schon in jungen Jahren eine arterielle Gefäßerkrankung entwickeln, warnt die Deutsche Gesellschaft für Endokrinologie (DGE).
Fette, die wie das Cholesterin mit der Nahrung aufgenommen werden, binden im Blut an Eiweißstoffe und bilden so genannte „Lipoproteine“. Zu dieser Gruppe gehört neben dem LDL-Cholesterin (Low Density Lipoprotein) auch das Lipoprotein(a). Studien der letzten Jahre zeigen, dass ein erhöhter Lipoprotein(a)-Spiegel ebenso wie ein erhöhter LDL-Cholesterinspiegel mit einem erhöhten Herz-Kreislaufrisiko einhergeht. Als gefährlich stufen Ärzte Blutwerte von über 30 Milligramm pro Deziliter ein.
Da der Lipoprotein(a)-Spiegel genetisch festgelegt ist, kann er durch eine Ernährungsumstellung kaum beeinflusst werden. Auch Medikamente stehen bislang sehr beschränkt zur Verfügung. Durch die Einnahme von Nikotinsäure-Präparaten kann der Lipoprotein(a)-Spiegel zwar bis zu 30 Prozent gesenkt werden. Inwieweit sich dadurch Herzinfarkte und Schlaganfälle verhindern lassen, ist allerdings noch offen.
Trotzdem ist es wichtig, Menschen mit einem erhöhten Lipoprotein(a)-Spiegel frühzeitig zu diagnostizieren: „Um Risikopatienten zu identifizieren, sollte bei Menschen, in deren Familien gehäuft Herz-Kreislauf-Erkrankungen auftreten, immer auch der Lipoprotein(a)-Wert bestimmt werden“, erklärt Professor Dr. med. Helmut Schatz, Bochum, Pressesprecher der DGE.
Bei einigen Patienten mit besonders hohen Lipoprotein(a)-Werten wenden Ärzte auch die regelmäßige „Lipidapherese“ für Lipoprotein(a) an. Bei dieser speziellen „Blutwäsche“ werden die Blutfette aus dem Körper entfernt. Noch diskutieren die Wissenschaftler jedoch darüber, welche Patienten von dieser aufwändigen und teuren Therapie tatsächlich profitieren. „Voraussetzung für eine Übernahme der Kosten einer Lipoprotein(a)-Apherese durch die Krankenkassen ist nicht nur ein deutlich (über 60 mg/dl) erhöhter Spiegel von Lipoprotein(a), sondern eine Normalisierung aller anderen Fettwerte und Risikofaktoren, bei fortschreitender Arterienerkrankung“, führt Professor Klaus Parhofer, München, einer der Lipidexperten in der DGE, aus. Als wichtigste therapeutische Maßnahme bei einem erhöhten Lipoprotein(a)-Spiegel gilt heute eine gute Einstellung aller anderen Risikofaktoren, wie zum Beispiel des Blutdrucks und eines bestehenden Diabetes. In erster Linie muss aber das LDL-Cholesterin (das „böse Cholesterin“) bereits tief abgesenkt sein. Das HDL-Cholesterin (High Densitiy Lipoprotein, das „gute Cholesterin“) sollte möglichst hoch liegen, was durch regelmäßige körperliche Aktivität erzielt werden kann, und die Triglyceride sollten im Normalbereich liegen. Viele Mediziner und Patienten setzen ihre Hoffnung zudem in neue Medikamente, die sich derzeit noch in der Entwicklung befinden.
Wie genau Lipoprotein(a) und Herz-Kreislaufrisiko zusammenhängen, ist unbekannt. Wissenschaftler vermuten, dass das Lipoprotein(a) ursächlich mit der Entstehung einer Arterienverkalkung (Atherosklerose) verknüpft ist.
Die DGE empfiehlt in diesem Zusammenhang auch den aktuell erschienenen „Patientenratgeber Fettstoffwechselstörungen – Lipoprotein(a)“ der Deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung von Fettstoffwechselstörungen und ihren Folgeerkrankungen DGFF (Lipid-Liga) e.V.“. Darin wird das derzeitige Wissen zum Lipoprotein(a) laienverständlich zusammengefasst.