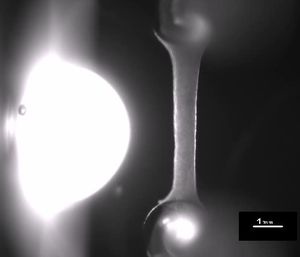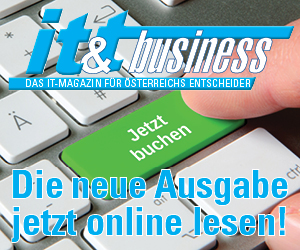3D-Herzmuskel aus Hautzellen gezüchtet
Personalisierte Behandlung von Leiden wie Vorhofflimmern und Verringerung von Tierversuchen
Hamburg/Berlin (pte011/14.12.2018/10:30) – Forscher des Deutschen Zentrums für Herz-Kreislauf-Forschung http://dzhk.de und des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) http://uke.de haben aus Hautzellen ein schlagendes menschliches Herzmuskelgewebe der
Vorhöfe gezüchtet. Die in "Stem Cell Reports" veröffentlichte Studie
könnte zur personalisierten Behandlung von Herzerkrankungen wie
Vorhofflimmern führen und Tierversuche verringern.
Retinsäure macht’s möglich
Das Wissenschaftler-Team aus Hamburg hat die Vorhofzellen mit der
Technologie der induzierten pluripotenten Stammzellen aus gespendeten
Hautzellen hergestellt. Diese Methode war zuvor schon angewandt worden,
um Zellen der unteren Herzkammern zu züchten. In der aktuellen Studie
modifizierten die Forscher die Technik durch Hinzufügen einer Chemikalie
namens Retinsäure. Dadurch erlangten die Zellen ähnliche Eigenschaften
wie Vorhofzellen.
Werden die Zellen dreidimensional gezüchtet, entstehen Streifen des
Vorhof-Herzmuskels, die sich wie ein echter Vorhofmuskel verhalten. Dies
könnte die Entwicklung von Medikamenten für Vorhofflimmern wesentlich
erleichtern, sagen die Experten. Der Herzmuskel aus dem Labor "schlägt",
leitet Strom und reagiert auf bestimmte Medikamente ebenso wie der
menschliche Vorhofmuskel. Als nächsten Schritt will das Team den
künstlichen Herzmuskel perfektionieren und ihn dazu bringen, sich wie
ein "kranker" Herzmuskel zu verhalten. Auf diese Weise könnten
Medikamente außerhalb des menschlichen Körpers getestet werden.
Einige Hautzellen reichen aus
Der Herzmuskel ist patientenspezifisch. Dies macht es möglich,
Medikamente an Herzgewebe zu testen, das von einer bestimmten Person
stammt, um genau die Vorhof-Erkrankung zu behandeln, die diese Person
hat. "Die Idee, dass wir Medikamente an einem Herzmuskel testen können,
der für einen bestimmten Patienten gezüchtet wurde, klingt fantastisch.
Unsere Forschung zeigt, dass dies jetzt Realität ist, wir benötigen
dafür nur einige Hautzellen. Unsere Studie kann helfen, Tierversuche zu
reduzieren oder sogar ganz zu vermeiden", so Marta Lemme vom Institut
für Pharmakologie und Toxikologie des UKE und Erstautorin der Studie.
Video eines schlagenden Herzmuskelstreifens zum Download: http://bit.ly/2SKTXiv