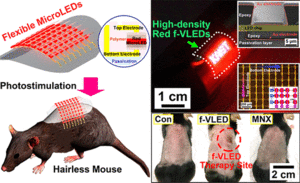Kalium – der vergessene Lebensretter
Internationale Empfehlungen doppelt so hoch wie hierzulande
Heidesheim am Rhein (pts022/07.05.2014/11:00) – Jeder Zweite stirbt mittlerweile an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung. Bluthochdruck und Rauchen sind dabei die wichtigsten Risikofaktoren, wobei Bluthochdruck das Rauchen als Hauptrisikofaktor für einen vorzeitigen Tod inzwischen überholt hat (GBD, 2010). Das ist umso erschütternder, da wir Menschen nicht nur das einzige Säugetier sind, das raucht und sich so selbst schädigt, sondern auch das einzige, das unter Bluthochdruck leidet – allerdings nur dann, wenn wir uns artfremd ernähren. Vor der Entwicklung der Landwirtschaft haben die Menschen täglich über zehn Mal mehr Kalium als Natrium verzehrt.
Ähnlich wirkungsvoll wie eine Natriumreduktion (Salzreduktion) ist eine erhöhte Kaliumzufuhr zur Senkung des Blutdrucks. Dabei setzt eine ausreichend hohe Kaliumzufuhr im Gegensatz zu einer medikamentösen Behandlung an der Ursache des komplexen Krankheitsbildes der Hypertonie an. Darüber hinaus kann Kalium aus der Nahrung oder aus Supplementen bei Hypertonikern das Schlaganfallrisiko mehr als halbieren.
Daher empfehlen die American Heart Association und das Food and Nutrition Board (höchstes wissenschaftliches Gremium der USA) Erwachsenen die Aufnahme von mindestens 4,7 Gramm Kalium täglich (FNB, 2004). Über 80 Prozent der Deutschen erreichen diese US-Empfehlung nicht (MRI, 2008). Obwohl Frauen mehr Gemüse und Obst verzehren als Männer, haben sie im Vergleich zur offiziellen US-Empfehlung dennoch ein Kaliumdefizit von 1560 Milligramm. Gemüse, Kräuter, Obst und Nüsse sind gute Kaliumlieferanten und enthalten gleichzeitig wenig Natrium. Durch eine Umstellung auf eine gemüse- und obstreiche sowie fettarme Ernährungsweise kann der Blutdruck erfolgreich gesenkt werden (Sacks et al., 2001). Doch lediglich 10 Prozent der Deutschen erreichen die von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfohlenen fünf Portionen Gemüse und Obst am Tag.
In der EU liegt die empfohlene Tagesdosis für Kalium bei nur 2 Gramm . Aufgrund der Bedeutung, die Kalium für die Aufrechterhaltung eines normalen Blutdrucks und unsere Gesundheit hat, ist diese Empfehlung jedoch viel zu niedrig.
WHO ändert Empfehlungen für die Kalium- und Natriumzufuhr
Aufgrund der klaren Studienlage hat auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ihre Richtlinien zur Zufuhr von Natrium und Kalium geändert, die nun lauten: mindestens 3,5 Gramm Kalium (WHO, 2012) und maximal 2 Gramm Natrium täglich (WHO, 2013). Je mehr Natrium aufgenommen wird, desto höher sollte auch die Kaliumzufuhr sein. Damit werde laut WHO nicht nur der Blutdruck, sondern auch das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlaganfall und Koronare Herzkrankheit gesenkt. Die Empfehlung zur Erhöhung der Kaliumzufuhr ist der WHO so wichtig, dass sie nachdrücklich ausgesprochen wird (strong recommendation).
Grund für diese Entscheidung war eine große Meta-Analyse im Auftrag der WHO (Aburto et al., 2013). Das Ergebnis: Der systolische Blutdruck wird bei einer Kaliumaufnahme von circa 3,5 bis 4,7 Gramm/Tag im Schnitt um 7,16 mmHg reduziert. Gleichzeitig betonen die Autoren, dass eine erhöhte Kaliumaufnahme über die Nahrung oder in Form von Supplementen bei Erwachsenen keine negativen Auswirkungen auf Nierenfunktion, Blutfette oder Catecholamin-Konzentrationen hatte. Für Personen, deren Nierenfunktion nicht durch Krankheit oder Medikamente beeinträchtigt wird, ist eine Erhöhung der Kaliumzufuhr über die Nahrung ungefährlich.
Unsere Ernährung hat sich rasant verändert, unsere Gene nicht
Vor der Entwicklung der Landwirtschaft haben die Menschen täglich nur etwa ein Gramm Natrium, aber 10 Gramm Kalium zu sich genommen (Eaton et al., 1997). Heute dagegen nehmen Deutsche laut der Nationalen Verzehrsstudie II (NVS II) im Schnitt nur 3,4 Gramm Kalium auf, dafür aber 3,1 Gramm Natrium (MRI, 2008 und 2013). Laut einer umfassenden Untersuchung des Forschungsinstituts für Kinderernährung in Dortmund (2006) liegt die tatsächliche Natriumaufnahme im Schnitt sogar 40 bis 70 Prozent höher als die wenig genauen Fragebogenwerte der NVS II.
Im Vergleich zur steinzeitlichen Ernährung hat sich das Verhältnis von Kalium zu Natrium um den Faktor 12 bis 50 hin zu Natrium verschoben. 3 Gramm Natrium sind beispielsweise bereits in einem Abendbrot aus zwei Scheiben Käsebrot, zwei Bockwürstchen, ein paar Oliven sowie einer halben Tüte Kartoffelchips enthalten.
Das Erbgut des modernen Menschen jedoch unterscheidet sich nicht wesentlich von dem seiner Vorfahren von vor wenigen tausend Jahren, weshalb der Stoffwechsel des Jetztmenschen auf die Ernährung von damals geeicht ist. Dieser kann mit den seit etwa zwei Generationen vorherrschenden industriell gefertigten Lebensmitteln nur schwer umgehen. Die ursprüngliche Ernährung des Menschen war reich an pflanzlicher Kost mit vielen basenbildenden Mineralstoffverbindungen, wie Kalium, Calcium und Magnesium, sowie arm an Natriumchlorid. Doch mit der Industrialisierung haben sich die Mineralstoffgehalte in unserer Nahrung stark verändert. Durch Verarbeitung und Konservierung haben der Gehalt an Natrium stark zu- und der Gehalt an Kalium abgenommen. Beim Garen von Gemüse und Kartoffeln können die Verluste an Kalium und Magnesium erheblich sein und bis zu 75 Prozent erreichen (Bognár, 1988). Über Kochwasser gehen besonders große Mengen an Kalium verloren.
Im Schnitt enthalten Gemüse und Kräuter mehr Kalium als Früchte. Frei wachsendes Gemüse und Obst enthält meist auch mehr Kalium als mit Nährlösungen im Treibhaus gezüchtete Lebensmittel.
Während Natriumchlorid aus Nahrungsmitteln fast komplett vom Körper aufgenommen wird, kommt die Kaliummenge, welche in Lebensmitteltabellen angegeben wird, nur teilweise im Körper an. Denn das meiste Kalium in Lebensmitteln ist intrazellulär gespeichert, so dass die Zellen erst zerstört werden müssen, bevor das Kalium freigesetzt wird und vom Körper aufgenommen werden kann.
Neben der Verschiebung des Natrium-Kalium-Verhältnisses gibt es ein weiteres evolutionsbiologisches Problem: Unser Organismus übersäuert schleichend (Sebastian et al., 2002). Die moderne westliche Ernährungsweise enthält einen hohen Anteil an tierischem Protein, das in Fleisch, Wurst, Fisch, Milch, Käse sowie Eiern enthalten ist und den Körper mit Säuren überlastet, sowie außerdem viel säurebildendes Phosphat, Sulfat und Natriumchlorid. Dagegen liefert uns diese Ernährungsweise vergleichsweise wenig basenbildendes Kalium, Magnesium und Calcium, die in pflanzlicher Nahrung enthalten sind.
Kaliummangel tritt erst intrazellulär auf und bleibt lange unentdeckt
Da in unserem Körper nur geringe Kaliumspeicher vorhanden sind, kommt es bei einer zu niedrigen Zufuhr von Kalium, wie dies heutzutage überwiegend der Fall ist, schnell zu einem intrazellulären Kaliummangel (Young, 2001). Um einem schweren Kaliummangel vorzubeugen, bedient sich unser Körper zweier Mechanismen: Einerseits wird die Ausscheidung über die Nieren vermindert, andererseits wird Kalium aus somatischen Muskelzellen freigesetzt (McDonough et al., 2002) – so lange, bis die Kaliumvorräte in den Zellen erschöpft sind. Da die Plasmakonzentrationen der Elektrolyte sehr eng reguliert werden und so auch der Plasmaspiegel an Kalium aufrechterhalten wird, bleibt der Serum-Kaliumwert auch bei einer stark variierenden Aufnahme relativ konstant. Folglich ist dieser kein zuverlässiger Indikator für eine angemessene Kaliumzufuhr (Lemann et al., 1991; Morris et al., 2006). Nur ein massiver intrazellulärer Kaliummangel spiegelt sich in veränderten Serum-Kaliumwerten wider. Doch schon vorher manifestieren sich die Elektrolytverschiebungen auf Dauer in der Zelle und beeinflussen das elektrochemische Potential – mit schwerwiegenden Folgen: von Bluthochdruck und Insulinresistenz über Nierenschäden, Nierensteine und Osteoporose bis hin zu Herzrhythmusstörungen, Schlaganfall und Herzinfarkt.
Entscheidend ist das richtige Natrium-Kalium-Verhältnis
Eine Ernährungsintervention sollte eine Erhöhung der Kaliumzufuhr mit einer Reduktion der Natriumzufuhr kombinieren. Denn tatsächlich kommt es auf das Verhältnis von Natrium zu Kalium an, wie der amerikanische Third National Health and Nutrition Examination Survey (Yang et al., 2011) bestätigte: Ein ungünstiges Natrium-Kalium-Verhältnis erhöhte das Gesamtmortalitätsrisiko und das Mortalitätsrisiko durch kardiovaskuläre Erkrankungen jeweils um 46 Prozent und das Mortalitätsrisiko durch ischämische Herzerkrankungen um 115 Prozent.
Kalium hat auch Auswirkungen auf die Salz-Sensitivität des Blutdrucks: Ist mehr Kalium verfügbar, reagiert der Körper mit einer geringeren Blutdruckerhöhung auf eine Natriumüberladung. Ein Übermaß an Natrium in unserer Ernährung bewirkt hingegen, dass Kalium vermehrt über die Nieren ausgeschieden wird und die Kaliumspiegel absinken (Luft et al., 1979). Eine hohe Natriumzufuhr erfordert also eine erhöhte Kaliumzufuhr, um den Blutdruck in einem gesunden Rahmen zu halten.
Kalium senkt drastisch das Risiko für Schlaganfall
Die US-amerikanische Studie von Ascherio et al. (1998) mit 43.738 Teilnehmern über einen Zeitraum von acht Jahren zeigte: Kaliumsupplemente senkten bei Hypertonikern das Schlaganfallrisiko um 58 Prozent (4,3 Gramm Kalium/Tag vs. 2,4 Gramm Kalium/Tag), auch wenn die Kaliumaufnahme zu gering war, um den Blutdruck zu senken. Bei Personen, die zeitgleich kaliumausscheidende Diuretika einnahmen, konnte durch eine Kaliumsupplementierung das Schlaganfallrisiko sogar um 64 Prozentgesenkt werden. Die Autoren der Studie schlussfolgerten, dass die stark protektiven Effekte von Kalium zu einem großen Teil unabhängig von dessen blutdrucksenkender Wirkung sind.
Niedrige Kaliumspiegel können sich besonders bei einer Einnahme von Diuretika negativ auswirken. Im Zusammenhang mit Vorhofflimmern und Serumkaliumwerten im niedrignormalen Bereich (< 4,1 mmol/l) konnte für Patienten ein um das 10-Fache erhöhtes Schlaganfall-Risiko festgestellt werden (Green et al., 2002).
Eine hohe Kaliumzufuhr in Form von basenbildenden Kaliumverbindungen wie Kaliumcitrat (enthalten in Gemüse und Obst) ist auch essentiell für die Regulation des Säure-Basen-Haushalts und den Nierenschutz, da sie die Freisetzung von toxischem Ammoniak in den Nieren senkt. Kalium ist das gesunde Diuretikum der Natur. Indem eine natriumarme und kaliumreiche Ernährung eingelagertes Salz und damit Wasser ausschwemmt, trägt sie auch zur Reduktion des Körpergewichts bei. Besonders bei Sport, Diabetes, Dauerstress, Diäten, Fastenkuren sowie bei Schwangeren und Stillenden sollte auf eine ausreichende Zufuhr an Mineralstoffen wie Kalium, Magnesium und Calcium geachtet werden.
Personen, die eine eingeschränkte Nierenfunktion haben oder Medikamente einnehmen, die die Kaliumspiegel erhöhen, müssen eine erhöhte Kaliumzufuhr mit ihrem Arzt abstimmen. Jedoch führen die meisten Diuretika (z. B. Thiazide, Schleifendiuretika) zu einem Kaliumverlust und niedrigen Kaliumspiegeln. Daher wundert es auch nicht, dass in der Notaufnahme etwa dreimal so häufig Patienten mit Kaliummangel als mit erhöhten Kaliumwerten zu finden sind (Arampatzis et al., 2013).
Mehr Infos zu "Dr. Jacobs Weg des genussvollen Verzichts"
Die Möglichkeiten einer gesunden Ernährung zur Prävention von Krankheiten und zur Verzögerung des Alterungsprozesses gewinnen angesichts des demographischen Wandels immer mehr an Bedeutung. Der Ernährungsplan nach Dr. Jacob vereint die klinisch und epidemiologisch erfolgreichsten Ernährungskonzepte der Welt unter Berücksichtigung der Insulin-, pH- und Redox-Balance: pflanzenbasiert und vitalstoffreich, fett- und salzreduziert. Die 2. Auflage des Fachbuches "Dr. Jacobs Weg des genussvollen Verzichts – die effektivsten Maßnahmen zur Prävention und Therapie von Zivilisationskrankheiten" von Dr. med. L. M. Jacob mit Geleitworten von Prof. Dr. Claus Leitzmann und Prof. Dr. med. Ingrid Gerhard beruht mit über insgesamt 1400 zitierten Studien auf einer breiten wissenschaftlichen Basis sowie auf persönlichen Anwendungs- und Erfahrungswerten. Die Zusammenhänge des Säure-Basen-Haushalts mit dem Mineralstoff-Haushalt werden ausführlich erläutert und mit über 400 wissenschaftlichen Studien belegt.
Ziel des Buches ist es, Klarheit in die vielen Widersprüche der oft gegensätzlichen ernährungstherapeutischen Ansätze zu bringen, indem nicht nur hunderte von epidemiologischen und klinischen Studien angeführt, sondern auch die physiologischen Hintergründe und Zusammenhänge wissenschaftlich erklärt werden. Aus den häufig eindimensionalen Studien und Ansätzen ergibt sich so ein mehrdimensionales Gesamtbild. http://www.drjacobsweg.eu
"Dr. Jacobs Weg des genussvollen Verzichts – die effektivsten Maßnahmen zur Prävention und Therapie von Zivilisationskrankheiten" (ISBN 978-3-9816122-3-3)
Über das Dr. Jacobs Institut für komplementärmedizinische Forschung
Das Dr. Jacobs Institut für komplementärmedizinische Forschung (http://www.drjacobsinstitut.de ) hat sich zum Ziel gesetzt, ganzheitliche Zusammenhänge in der Ernährungs- und Naturheilkunde wissenschaftlich aufzuklären. Zu den aktuellen Forschungsgebieten gehören die Pathogenese von Zivilisationserkrankungen, das metabolische Syndrom, Ernährungsfaktoren bei Prostatakrebs, Granatapfel-Polyphenole, Mineralstoff-, Säure-Basen- und Energie-Haushalt im Zusammenhang mit Leberstoffwechsel und Darmmikrobiom sowie Omega-3-Fettsäuren.