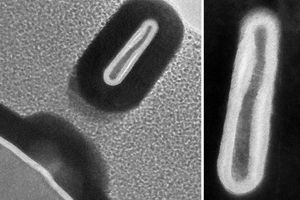Saarbrücker Masterstudiengang verbindet Computer- und Bildungswissenschaften
Er ist an der Schnittstelle zwischen Computer- und
Bildungswissenschaften angesiedelt und vermittelt wichtige Kenntnisse
aus Pädagogik, Psychologie und Informatik – der Masterstudiengang
„Educational Technology“ an der Universität des Saarlandes.
Bildungstechnologen erforschen beispielsweise, wie neue Techniken im
Schulunterricht oder bei Schulungen von Mitarbeitern in Unternehmen
sinnvoll genutzt werden können. Studieninteressierte können sich noch
bis zum 15. Juli an der Saar-Uni bewerben.
Im viersemestrigen Masterstudiengang „Educational Technology“ stehen
neuartige Technologien im Mittelpunkt. „Wir erforschen, wie diese zum
Beispiel in den sozialen Medien oder auch im Klassenzimmer helfen,
Wissen zu konstruieren, zu kommunizieren und anzuwenden“, erklärt Armin
Weinberger, Professor für Bildungstechnologie und Wissensmanagement an
der Saar-Uni. „Gerade für die Akzeptanz der neuen Medien ist es wichtig,
dass man über pädagogische und psychologische Kenntnisse verfügt. Denn
alle gut gemeinten Bildungstechnologien können Wissenskonstruktion und
-kommunikation nur so weit fördern, als sie pädagogisch-psychologisch
fundiert sind.“
Das Team um Weinberger setzt in seiner Forschung auf Methoden, die
zwischen den Computerwissenschaften und den Bildungswissenschaften
angesiedelt sind. „Wir vermitteln unseren Studenten unter anderem
pädagogische Konzepte, die mit technischen Mitteln beispielsweise in den
Unterricht eingebunden werden“, sagt der Professor.
Schwerpunkte des Studienganges sind Computer- und
Bildungswissenschaften. Außerdem können Studenten weitere Fächer aus
einem Wahlbereich belegen und eigene Schwerpunkte setzen. So ist es etwa
möglich, Einblicke in Bereiche wie Künstliche Intelligenz oder
Mensch-Maschine-Interaktion zu erhalten. Neben den Uni-Fachrichtungen
Bildungswissenschaften und Informatik sind das Deutsche
Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz und die Hochschule für
Technik und Wirtschaft am Studiengang beteiligt.
Der Studiengang verbindet Pädagogik, Psychologie und Informatik
miteinander. Bewerber sollten daher auch einen Bachelorabschluss in
einem dieser Fächer oder einem ähnlichen besitzen. Die
Lehrveranstaltungen finden in deutscher und englischer Sprache statt.
Daher sollten Studieninteressierte sehr gute Kenntnisse in beiden
Sprachen mitbringen. Noch bis zum 15. Juli können sich Interessierte für
das Studium an der Saar-Uni bewerben.
Weitere Informationen zum Studiengang und zur Bewerbung gibt es unter edutech.uni-saarland.de/de