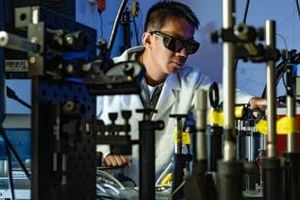Saarbrücker Informatik-Professor sorgt per Software für Lernerfolg während der Vorlesung
Studenten haben aufgerüstet. In die Vorlesung nehmen sie
schon lange nicht mehr nur Block, Bleistift und Bücher mit. Auf den
hochgeklappten Tischen finden sich inzwischen ebenso viele Laptops wie
Smartphones, denn ein drahtloser Zugang zum Internet ist in den meisten
Hörsälen vorhanden. Damit sinkt jedoch auch die Aufmerksamkeit der
Studenten. Ein Saarbrücker Informatik-Professor erkämpft sich diese nun
zurück – mit einer Software, die unter anderem an der Universität des
Saarlandes entwickelt wurde. Die Studenten haben positiv darauf
reagiert.
Eine Gruppe von Informatik-Studenten hat sich im Hörsaal in einer der
letzten Reihen gesetzt. Hinter aufgeklappten Laptops, flankiert von
flachen Tablet-PCs und Smartphones, verfolgen sie die
Einführungsvorlesung zur Programmierung, die von Bernd Finkbeiner,
Informatik-Professor an der Universität des Saarlandes, gehalten wird.
„Dass die Studenten mit Laptop und Co. in die Vorlesung kommen, ist
heute eher die Regel als die Ausnahme“, so Finkbeiner. Allerdings habe
man als Dozent immer das mulmige Gefühl, dass Studenten darauf nicht nur
der Präsentation des Lehrstoffes folgen, sich Notizen machen, sondern
auch ganz andere Dinge unternehmen.
Was Finkbeiner nur vermutet, haben Forscher des Lehrstuhls für
Bildungstechnologie und Wissensmanagement an der Saar-Uni untersucht.
Dazu analysierten sie 21 Vorlesungen auf Video aus den Bereichen
Informatik, Wirtschaft und Pädagogik, filmten zusätzlich fünf
Vorlesungen mit Zustimmung der Studenten und befragten die darin
versammelten 664 Studenten mit einem Fragebogen. „Die Ergebnisse deuten
an, dass eine Vorlesung nur noch schwach mit den studentischen
Tätigkeiten während dieser zusammenhängt. Studenten nutzen mobile
Endgeräte vornehmlich für andere Zwecke“, lautet ihr Fazit.
Finkbeiner setzte deswegen im vergangenen Wintersemester erstmals die
Software „Backstage“ in der Vorlesung „Programmierung I“ ein.
Entwickelt an der Universität des Saarlandes und der
Ludwig-Maximilians-Universität München ermöglicht Backstage den
Studenten eine Vielzahl von Funktionen, die sie sonst aus sozialen
Netzwerken kennen. Sie können nicht nur die Folien, mit denen der Dozent
den Lehrstoff präsentiert, am Laptop mitverfolgen, sondern unter
anderem diese auch anonym kommentieren und mit virtuellen Fragezetteln
bekleben. Gleichzeitig können sie über das Programm signalisieren, wenn
der Dozent den Stoff zu schnell erklärt. Darüberhinaus sehen sie auch
die Fragen ihrer Kommilitonen, können diese selber beantworten oder
zumindest daraufhin bewerten, wie wichtig die Antwort auf diese Frage
für den eigenen Lernerfolg ist.
„Die Fragen, die von den meisten Studenten als wichtig markiert
wurden, kann ich mir während der Vorlesung direkt über Backstage
anzeigen lassen und sofort beantworten“, erklärt Finkbeiner. Das sei
sehr wertvoll, zumal sich bei über 200 Studenten im Hörsaal viele
Studenten nicht trauen, mündlich nachzufragen, so Finkbeiner. Aus dem
gleichen Grund nutzt er auch die Quiz-Funktionalität von Backstage.
Ähnlich wie bei der Sendung „Wer wird Millionär“ kann er jederzeit eine
Quizfrage einblenden und dafür Antworten vorgeben. Der einzelne Student
kann über Backstage die richtige Antwort auswählen, das Gesamtergebnis
sieht der Dozent sofort. Auf diese Weise erhält er einen weiteren
Hinweis, ob er zur nächsten Lerneinheit voranschreiten kann oder den
Stoff nochmals wiederholen soll.
Für die Studenten und Finkbeiner hat sich dieser Aufwand gelohnt. In
der anschließenden Evaluation, die vom Lehrstuhl für Differentielle
Psychologie und Psychologische Diagnostik durchgeführt wurde, gaben 143
von 181 Studenten der Vorlesung in punkto Organisation die Note 1. Unter
den Freitextantworten zur Frage „Was fand ich besonders gut?“ tauchen
immer wieder zwei Namen auf: Finkbeiner und Backstage.
Hintergrund: Informatik an der Universität des Saarlandes
Den Kern der Saarbrücker Informatik bildet die Fachrichtung Informatik
an der Universität des Saarlandes. In unmittelbarer Nähe forschen auf
dem Campus sieben weitere weltweit renommierte Forschungsinstitute.
Neben den beiden Max-Planck-Instituten für Informatik und
Softwaresysteme sind dies das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche
Intelligenz (DFKI), das Zentrum für Bioinformatik, das Intel Visual
Computing Institute, das Center for IT-Security, Privacy and
Accountability (CISPA) und der Exzellenzcluster "Multimodal Computing
and Interaction".