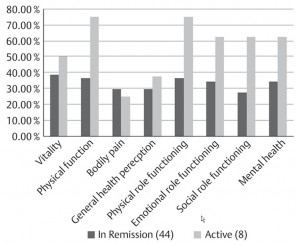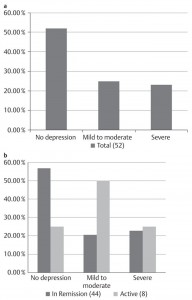Experten entwerfen Trainingsprogramm für schwache Herzen
fzm, Stuttgart, Mai 2014 – Früher wurde Menschen mit Herzschwäche vor allen Dingen Ruhe verordnet. Heute sollen sie nach Möglichkeit aktiv am Leben teilnehmen und auch ein wenig Sport treiben. Eine Expertin stellt in der Fachzeitschrift „DMW Deutsche Medizinische Wochenschrift“ (Georg Thieme Verlag, Stuttgart. 2014) ein gezieltes Ausdauer- und Krafttraining für Menschen mit chronischer Herzinsuffizienz vor.
Als chronische Herzinsuffizienz bezeichnen Mediziner jede dauerhafte Funktionsstörung des Herzmuskels. Die Betroffenen geraten körperlich schnell an ihre Grenzen. Jede Bewegung ermüdet sie. Nach der geringsten Anstrengung ringen sie nach Luft. Die Patienten werden sparsam in ihren Bewegungen, körperliche Aktivitäten suchen sie nach Möglichkeit zu vermeiden, berichtet Dr. Silja Schwarz vom Zentrum für Prävention und Sportmedizin der Technischen Universität München. Doch die Ruhe bekommt den meisten Patienten nicht. Sie werden körperlich immer schwächer, worunter am Ende auch der Herzmuskel leidet.
Kardiologen raten den Patienten deshalb zu mehr Bewegung und sportlichen Übungen. Mehrere Studien haben laut Dr. Schwarz gezeigt, dass sich die körperliche Belastbarkeit der Patienten verbessern lasse. Ein Training steigere die Lebensqualität und es senke die Zahl der Krankenhausaufenthalte. Langfristig könnte es sogar die Lebenszeit der Patienten verlängern. Die „European Society of Cardiology“, der europäische Dachverband der Herzspezialisten, hat jüngst sogar eine Klasse-1-A-Empfehlung für das körperliche Training ausgegeben.
Sport- und Rehamediziner wie Dr. Schwarz haben inzwischen Trainingsprogramme für Patienten mit Herzinsuffizienz entwickelt. Empfohlen wird eine Kombination aus Ausdauereinheiten und einem Muskelaufbau. Das Prinzip lautet „Start low – go slow“. In den ersten vier Wochen sollen die Patienten sich langsam daran gewöhnen, körperlich aktiv zu sein. Dr. Schwarz empfiehlt schnelles Spazierengehen, Treppensteigen, Gartenarbeit sowie eine aktive Freizeitgestaltung. Danach kommen die ersten Trainingseinheiten.
Das Ausdauertraining sollte zunächst auf dem Fahrradergometer oder Laufband im Gehprogramm unter Aufsicht begonnen werden, rät die Sportmedizinerin. Später könnten die Patienten auch eigenverantwortlich Sportarten wie Radfahren, Walking oder Nordic-Walking betreiben. Bei besser belastbaren Patienten seien auch Skilanglauf, Joggen oder Übungen auf Crosstrainer und Stepper möglich. Von Schwimmen wird abgeraten. Der Wasserdruck belastet das Herz und im Fall eines Schwächeanfalls droht der Ertrinkungstod.
Üblich ist ein kontinuierliches Training über anfangs zehn bis 15 Minuten, das später auf bis zu 45 Minuten gesteigert werden kann. Dr. Schwarz favorisiert ein Intervall-Ausdauertraining, bei dem die Patienten zwischendurch immer wieder kurzfristig auf 60 bis 95 Prozent ihrer maximalen Pulszahl gehen. Das steigert nach Auskunft der Expertin nicht nur die körperliche Belastbarkeit. Auch eine Verbesserung der Herzleistung sei möglich. Ein Intervalltraining ist allerdings nur unter Überwachung durch geschultes Personal ratsam.
Parallel zum Ausdauersport wird den Patienten ein begrenztes Muskelaufbautraining empfohlen. Am Anfang stehen einfache gymnastische Übungen noch ohne Geräte. Bei verbesserter körperlicher Fitness könnten die Patienten dann aber im Fitness-Studio trainieren. Auch hier gilt: Niedrig beginnen und langsam steigern.
Vor dem Beginn des Trainings sollten sich alle Patienten ärztlich untersuchen lassen. Die Kardiologen haben hier Regeln festgelegt. Teilnehmen dürfen nur Patienten mit einer „stabilen“ Erkrankung: Der körperliche Zustand darf sich nicht akut verschlechtert haben und es dürfen keine Durchblutungsstörungen in den Herzkranzgefäßen vorliegen. Auch Patienten mit neu aufgetretenen Herzrhythmus- oder Kreislaufstörungen müssen zunächst medizinisch betreut werden, am besten von einem Arzt, der die Trainingsintensität der Patienten ermitteln und ein individuelles Trainingsprogramm für sie entwerfen kann.
S. Schwarz und M. Halle:
Ausdauer- und Krafttraining bei Herzinsuffizienz
DMW Deutsche Medizinische Wochenschrift 2014; 139 (16); S.845-850